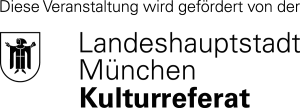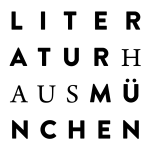Seit 25 Jahren begleitet die Zeitschrift DAS GEDICHT kontinuierlich die Entwicklung der zeitgenössischen Lyrik. Bis heute ediert sie ihr Gründer und Verleger Anton G. Leitner mit wechselnden Mitherausgebern wie Friedrich Ani, Kerstin Hensel, Fitzgerald Kusz und Matthias Politycki. Am 25. Oktober 2017 lädt DAS GEDICHT zu einer öffentlichen Geburtstagslesung mit 60 Poeten aus vier Generationen und zwölf Nationen ins Literaturhaus München ein. In ihrer Porträtreihe stellt Jubiläumsbloggerin Franziska Röchter jeden Tag die Teilnehmer dieser Veranstaltung vor.
Als Konzertorganist hat er in vielen Ländern Europas gespielt und Radio-, Fernseh- und CD-Aufnahmen gemacht.
Gedichte von ihm erschienen in diversen Literaturzeitschriften, Zeitungen und Anthologien. Ausgewählte Gedichte sind in über zehn Fremdsprachen übersetzt und publiziert worden. Lesungen in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Frankreich, Rumänien, Israel, in der Slowakei und in der Ukraine. 2009 erhielt er den Buchpreis Internationales Literaturfestival Sighet (Rumänien) für »Die Kuh von Gampelen / Vaca din Gampelen«, 2011 war er Träger der Internationalen Trophäe Ars Maris am Internationalen Kulturfestival Reghin (Rumänien).
Messmer veröffentlichte diverse Artikel, Kolumnen und Essays in »orte«, Schweizer Literaturzeitschrift, Oberegg AI (Redaktionsmitglied), und in »du«, die Zeitschrift der Kultur, Zürich. Er ist Mitglied des BOV (Berner Organistenverband), des ISSV (Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftsteller Verein), des Vereins Pro Lyrica, des AdS (Autoren der Schweiz) und des BSV (Berner Schriftsteller/innen Verein).
Nichtschweizer wie Schweizer dürfen froh sein, dass die Muttersprache von Erwin Messmer nicht die Walliser Mundart ist. Der Autor und Musiker sprach mit Franziska Röchter über das Schweizerdeutsche, die Bipolarität im Leben und die neue Struktur des orte-Verlags.
Ein wesentlicher Ansporn für mein Schreiben ist mir immer wieder die Sprache selbst.
Lieber Erwin Messmer, in Ihrem aktuellen Gedichtband »Nur schnell das Glück streicheln« (Edition 8, Zürich 2017) steht das Vergängliche sehr im Mittelpunkt. Bereits im zweiten Gedicht »Wie am Schnürchen« bringen Sie das Leben komplett auf den Punkt: Neu geboren hängt das Individuum an der Schnur, diese bleibt zeitlebens erhalten, auf ihr reihen sich die verschiedenen Stadien des Lebens auf, bis sie am Ende schließlich reißt. Wann ist für Sie das Thema des verstreichenden Lebens so wichtig geworden?
Dieses Thema war für mich von früher Jugend an zentral. Als ich vielleicht zehn Jahre alt war, sagte mir meine Mutter einmal während eines Gangs zur Kirche (der dauerte immer gute zwanzig Minuten und bot sich oft geradezu an für gute Gespräche), sie habe nur eine Zukunftsangst: nämlich vor dem Tod ihrer Mutter, meiner Großmutter. Von da an war das Vergängliche, die unerbittlich vorwärts schleichende Zeit, tief in meinem Bewusstsein eingeprägt. Meine Großmutter starb dann sechs Jahre später auf dem Fußgängerstreifen, unter einem Auto.
In einem weiteren Gedicht, »Menuett«, bezeichnen Sie das Leben als Sumpf und Kloake, aus dem das Lyrische Ich nur sporadisch, für den Anblick ›flüchtiger‹ Schönheit, auftaucht, aus einer Art Lebenssucht heraus. Ist das nicht eine eher pessimistische Sicht der Dinge – oder würden Sie sagen: eine realistische?
Sicher beides. Aber auch eine Vision des Wunderbaren im Leben. Hören Sie sich Don Giovanni an! Während eines ganzen Aktes säuselt dieses leichtfüßige Menuett immer wieder von Neuem frohgemut über diabolische Dialoge hinweg, über Liebesintrigen und menschliche Verstrickungen. Sowas bringt nur Mozart zustande. Seine Musik beglückt, und sie trug viel dazu bei (und tut es auch weiterhin), dass ich im Grund meiner Seele ein lebensbejahender, um nicht zu sagen: ein optimistischer Mensch geblieben bin. Beachten Sie das »immer wieder« in meinem Gedicht.
Sumpf und Kloake sind keine autonomen Einheiten. Der ›Alltag‹ ist für mich eine Synthese aus den Antipoden »Sumpf und Kloake« auf der einen und aus Schönheit, Glück, Liebe auf der anderen Seite. Es sind zwei Kehrseiten derselben Medaille.
Der Dialekt ist für mich nach wie vor gleich wichtig wie die hochdeutsche Sprache.
In Ihrem Gedicht »Polyglott« erwähnen Sie die sich Ihnen nicht bis ins Letzte erschließbare Grammatik Ihrer Muttersprache, das Buchstabengewimmel, den lückenhaften Wortschatz. Ich nehme an, von Ihrer Mutter haben Sie den Sankt Galler Dialekt? »Auf den Fußspuren meiner Mutter / gelange ich niemals zu ihnen«, lauten die letzten beiden Zeilen dieses Gedichtes, wobei »ihnen« fremde Länder und Menschen meint. Haben Sie sich durch Ihre Muttersprache, durch den erworbenen Dialekt jemals beeinträchtigt, benachteiligt gefühlt?
Keineswegs. Im Gegenteil! Der Dialekt, also meine eigentliche Muttersprache, ist der Humus, aus dem auch die Blüten der deutschen Kultur wunderbar sprießen konnten, schon im Kindergartenalter und dann systematisch ab der ersten Primarschulklasse, als ich mit immer größerer Begeisterung die deutsche Sprache und Dichtung zu lernen und zu lieben begann. Der Dialekt ist für mich aber nach wie vor gleich wichtig wie die hochdeutsche Sprache. Darum schreibe ich ja auch in beiden Sprachen. Sie sind – wiederum sei das Bild erlaubt – die Kehrseiten ein und derselben Medaille.
Im von Ihnen angesprochenen Gedicht »Polyglott« sollte allerdings das Wort »Muttersprache« nicht eins zu eins als Sprache und nur als solche gelesen werden. Es ist eine Chiffre, die tiefer greift, steht für alle Techniken der Sozialisierung und für alle Hilfsmittel, die sich dem Kind bieten, seine Welt einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und die waren (und sind es auch heute noch) durch familiäre, religiöse, ideologische und mediale (heute mehr denn je) Prägungen immer ›sackgassengefährdet‹, unvollständig, weisen Lücken auf, machen uns nur bedingt fähig, uns der ›Geworfenheit‹ zu stellen, die Unwägbarkeiten und Unverständlichkeiten unseres individuellen Schicksals und überhaupt das letztlich Geheimnis bleibende Phänomen ›Leben‹ in den Griff zu bekommen. »Muttersprache« und »Fremdsprache« – wieder zwei Antithesen, welche die Synthese Leben ausmachen.

Es gibt ja eine Vielzahl Schweizer Dialekte, die sich teilweise stark unterscheiden, zum Beispiel in Graubünden, Sankt Gallen, Basel, Bern, Wallis – können alle Schweizer sich gegenseitig verstehen?
Im Allgemeinen ja. Am schwersten verständlich ist für ungeübte »Üsserschwitzer« (so nennen die Walliser alle Schweizer außerhalb ihres Kantons) wohl der Walliser Dialekt. Aber sobald man, meist durch Freundschaften, sich etwas eingehört hat, versteht man auch diesen sehr gut. Ein anderer, eher schwer verständlicher Dialekt ist der Appenzeller Dialekt, einer der urwüchsigsten der Schweiz. Ich liebe ihn sehr und verstehe ihn gut. Meinen St. Galler Dialekt, und ebenfalls die diesem ähnlichen Dialekte aus dem Thurgau und aus Schaffhausen, sind aber wegen der offenen Vokalisierung für alle Schweizer am leichtesten verständlich, ebenfalls für alle Leute im ›großen Kanton‹, wie wir Deutschland manchmal augenzwinkernd nennen.
Sprechen Sie mehr als einen Dialekt?
Nein. Ich spreche nur den Dialekt meiner Kindheit, den St. Galler Dialekt. Und dies, obwohl ich schon seit vierzig Jahren in Bern lebe, wo ein ganz anderer Dialekt, das Bärndüütsch, gesprochen wird, wohl der beliebteste Dialekt der Schweiz, der sich auch ausgezeichnet für Dichtung, Chanson und Mundartrock eignet. Ich kenne aber keinen Ostschweizer, der in Bern lebt und sich diesen Dialekt angeeignet hat, welcher sich – weil sein Schnabel nun mal total anders gewachsen ist – damit nicht in einer gewissen Weise lächerlich machen würde. Zum Glück gibt es nur wenige Ostschweizer, die sich dieser ›Anpassung‹ unterzogen haben.
Das Problematische im Leben, die Aporien des Daseins reizen viel eher zu einer Auseinandersetzung mit den Mitteln der Poesie.
Sie blicken recht melancholisch auf Ihre Kindheit zurück. In Ihrem Text »Hieroglyphen« beschreiben Sie die Welt voller Wirrwarr an Zeichen, voller Unverständlichkeit, als Dschungel, der nur mit dem Buschmesser in der Hand durchquert werden kann, das Lyrische Ich als eines, das ständig das Nachsehen hat. Sind Sie denn nicht eher ein mit seinen musischen Talenten gesegneter Mensch? Quasi ein ›Privilegierter‹?
Es handelt sich um eine (wenn auch omnipräsente und prägende) Facette in meinem und in jedem Leben. In einem Gedicht kann und will man ja nicht alle Aspekte unterbringen. Es gibt auch Gedichte von mir, in denen die andere Seite, das Aufgehobensein, die Geborgenheit in diesem Leben, in der Vergänglichkeit allerdings, auf eine wie auch immer moderate Weise gefeiert wird. Beachten Sie in diesem Zusammenhang Gedichte wie »Drei Küchenzettel«, »Im Konzert«, »Einlass«, »Kapuzinerkirche« oder »Hohe Schule des Verschwendens«.
Und überdies: Das Ich, das im Gedicht spricht, muss und kann nicht mit dem Ich des Autors gleichgesetzt werden. Und: Jedes Gedicht bedeutet ja auch Spiel. Es ist immer ein lustvoller Versuch, etwas poetisch in eine bestimmte Richtung zu treiben und zu schauen, was dabei herauskommt. Dass in meinen Gedichten dieses Spiel oft in eine pessimistische Richtung weist, hat auch damit zu tun, dass das Beglückende im Leben nicht unbedingt einer poetischen Umsetzung bedarf. Es genügt diesbezüglich, die Gunst des Augenblicks in vollen Zügen zu genießen (und das kann ich gut!). Es gibt ja genügend – meist pseudopoetische – Erbauungsliteratur im Mäntelchen der Gedichtform, da brauche ich kein weiteres Wasser in den Rhein zu gießen. Das Problematische im Leben, die Aporien des Daseins reizen viel eher zu einer Auseinandersetzung mit den Mitteln der Poesie.
Und sicher: Ich bin zumindest nicht unzufrieden mit meinen Begabungen, so begrenzt sie auch sind
Das Bipolare im Leben ist für mich eine Grundbefindlichkeit.
Wunderbar, wie Sie in dem Gedicht »Leichten Muts« das Bipolare des Menschen, des Lyrischen Ichs, nämlich das Schwere, das Schwermütige, mit dem Leichten, dem Leichtsinnigen, in einem Text vereinen. Genauso bipolar stehen sich ja die beiden Sprachausprägungen Hochdeutsch und Mundart gegenüber. Durch Ihre Publikationen versuchen Sie eine Annäherung.
Sehen Sie, nun sprechen Sie es ja selber aus. Das Bipolare im Leben (in welchem die beiden Pole zur Einheit verschmolzen werden) ist für mich eine Grundbefindlichkeit.
Ein wesentlicher Ansporn für mein Schreiben ist mir immer wieder die Sprache selbst. Ein Wort, das mir in seiner Schönheit, in seiner merkwürdigen Klanglichkeit, in seiner Doppel- oder gar Vieldeutigkeit auffällt. Ein Satz, aufgeschnappt im Zug oder in einer Kneipe, und so weiter. Je nach Stimmung, meist intuitiv, schreibe ich dann automatisch in der einen oder in der anderen Sprache.
Erwin Messmer liest:
»Än Schmätterling über dä Gglais«
»Toonlaitärä«
»Rääzel«
Aus: »Äm Chemifäger sis Päch« (Drey-Verlag, Gutach 2014)
Als Musiker waren Sie seit 1983 Organist an der evangelisch-reformierten Kirche Bern-Bümpliz tätig, mittlerweile sind Sie aber diesbezüglich im Ruhestand. Fehlt Ihnen da nicht etwas?
Nein, es fehlt mir wirklich nichts. Ich übe nach wie vor täglich intensiv am Instrument, absolviere als Stellvertreter für verhinderte Kolleginnen und Kollegen monatlich etwa zweimal Orgeldienste in verschiedenen Kirchen der Stadt und der Region Bern, übe daneben auch vermehrt wieder Klavier und Klarinette.
Musizieren ist für mich, wie das Schreiben, wie die Sexualität, und überhaupt wie jede Beschäftigung, in die man sich voll und ganz, mit Leib und Seele hineingibt, ein wunderbares Mittel, die Zeit anzuhalten, völlig bei sich anzukommen.
Welchen Stellenwert hat die Musik in Ihrem Leben, verglichen mit der Schriftstellerei? Musizieren Sie viel privat, gehen Sie immer noch auf Konzertreisen?
Musizieren ist für mich wie Essen und Trinken, also eine tägliche Übung. Sie ist, wie das Schreiben, wie die Sexualität, und überhaupt wie jede Beschäftigung, in die man sich voll und ganz, mit Leib und Seele hineingibt, ein wunderbares Mittel, die Zeit anzuhalten, völlig bei sich anzukommen. Die Steuererklärung, die Börsenkurse, die sinistre Weltlage, ja sogar der Tod, das alles bleibt dann für Stunden außen vor. Dafür braucht es übrigens nicht immer einen schöpferischen Akt. Auch rezeptives sich Versenken, Lesen oder konzentriertes Musikhören, Spazieren, Wandern, die Begegnung mit Landschaft und Natur, all das kann auch und gerade in weniger inspirierten Phasen ein ähnliches Hochgefühl des Daseins auslösen. Sogar das Mitfiebern bei einem spannenden Fußballspiel ist durchaus dazu geeignet. Ein aktiver Dichter ist man ja nicht rund um die Uhr. Manchmal vergehen Tage oder gar Wochen, ohne dass es einen Grund gäbe, etwas zu Papier zu bringen. Es bieten sich genügend absolut hochkarätige Möglichkeiten von außen, die dazu angetan sind, einen aus dem Dschungel des Alltagseinerleis zurückzuführen in die eigene Mitte. Und nur wer fähig ist, aufzunehmen, kann auch gelegentlich selber etwas Substantielles schaffen.
Aber zurück zur Musik: Als ausübender Musiker hat man auch an einem ›schlechten Tag‹ immer die Chance, zu arbeiten, Partituren zu entziffern, Fingersätze zu notieren und so weiter. Deshalb sitze ich täglich an meinen Instrumenten. Anders ist es in Bezug auf das Schreiben: Da warte ich (im Gegensatz zu zahlreichen Gedichte schreibenden Kolleginnen und Kollegen), bis mir wieder mal etwas in den Sinn kommt.
Und ja: Ich spiele noch regelmäßig Konzerte, auch gelegentlich mit fantastischen Duopartnern, wie etwa mit Armin Rosin (Posaune) oder Alexandre Dubach (Violine).
Seit 1992 sind Sie Redakteur der Schweizer Literaturzeitschrift »orte«. Der orte-Verlag wurde 2015 vom Appenzeller Verlag übernommen. Der wiederum wird, wie weitere Verlage, seit Januar 2015 beherbergt vom Verlagshaus Schwellbrunn. Sind Sie immer noch für die Literaturzeitschrift tätig? Wie gefallen Ihnen solche Entwicklungen im Verlagssektor, wird da nicht auch die Eigenständigkeit der einzelnen Verlage aufgegeben?
Das Verlagshaus Schwellbrunn ist eigentlich die Domäne der Appenzeller Verlags AG, welche 2015, nachdem sie sich von der NZZ-Mediengruppe gelöst hatte und selbständig wurde, von Herisau nach Schwellbrunn ins alte Schulhaus umzog, das zu diesem Zweck optimal saniert und mit einer modernen Infrastruktur für ein ambitioniertes Verlagswesen umgebaut wurde. Der Appenzeller Verlag betreute schon vorher zwei weitere Verlagszweige, so die Edition punktuell und den Toggenburger Verlag, alle unter der Regie des Verlagsleiters Marcel Steiner und seiner Frau Yvonne.
Als Werner Bucher, der Gründer und Leiter des orte-Verlags und der orte-Literaturzeitschrift, krankheitshalber alle seine Funktionen niederlegen musste, sprang seine langjährige Rechte Hand Virgilio Masciadri in die Bresche, als Verlagsleiter und als Chefredaktor der Zeitschrift. Aber leider verstarb dieser kurze Zeit später an einer heimtückischen Krebserkrankung. Verlag und Zeitschrift standen vor dem Aus. Davor rettete sie Marcel Steiner, der Leiter des Appenzeller Verlags und Direktor des Verlagshauses Schwellbrunn. Der orte-Verlag existiert nun weiter unter dem Dach des Appenzeller Verlags, mit einem eigenen Programm (nach wie vor mit den Schwerpunkten Lyrik und Kriminalroman), ebenso die orte-Zeitschrift unter der Leitung zweier literaturkundiger und organisatorisch gewiefter Frauen, die sich in die Chefredaktion teilen. Ein Glücksfall also. Die Zeitschrift ist vielleicht heute sogar etwas unabhängiger als zur Werner Buchers Zeiten, der diese älteste noch existierende Literaturzeitschrift der Schweiz doch sehr mit seiner eigenen Handschrift geprägt hatte. Und ja: Ich bin nach wie vor in der Redaktion tätig.
Verraten Sie mir noch, was »Gschlaik und Gschtelaasch« auf Hochdeutsch heißt?
Ein »Gschlaik« ist einerseits ein schweres Gepäckstück, an dem man schwer zu schleppen hat (»schlaikä« heißt soviel wie »schleppen«). Das Wort wird aber auch verwendet für problematische Beziehungen, besonders für erotische Beziehungen außerhalb der Ehe, also für sogenannte Affären. »Gschtelaasch« wiederum leitet sich vom Wort »Gestell« bzw. »Stellage« ab, verweist also auf sperrige Möbel und anderen platzversperrenden Hausrat.
Lieber Erwin Messmer, ganz herzlichen Dank für dieses sehr informative Gespräch!
Goldigs Hoochzig
All Morgen
äm Seggsi
segsi i sin
Zuug iiggschtigä
Nödämol
gglächlät hegsi
wenn si
a sim Aptail
väbiitigerät seg
mit Stöckli-
schue
undemä
Mini-
röckli
Guet etz segsi
zwoor nümä
gad sexy
däföör liäb
und sit ggnaau
füffzg Johr
sini Frau
© Erwin Messmer, Bern
Wiliam Shakespeare
Sonett Nr. 18
Chunnt meer zu deer än Sommertaag in Sii,
wot’duu doch milder, vill konschtanter bisch?
Än Rägäschturm – ’s isch mittem Bluescht väbii,
kumm chunnt dä Sommer, ischer scho vom Tisch.
Sis Aug isch Gluet, was aaluegt fangt gad Füür,
ufzmool weert t‘ Wält we Äschä trooschloos graau.
‚S isch all Joohr s’Gliich dämitt, au wider hüür.
Zuefall? Natuur? I waissäs o nöd ggnaau.
Dinn Sommer aber, dää söll eewig sii.
I will, dass t‘ dini Blüätä niä välüürsch.
I minä Väärs isch’s mit dim Tood väbii,
dass t‘ niä än Schattä vo dem Pralhans gschpüürsch.
Solang för ’s Läbä Läsä isch we Schnuuf
gooht diä Poeetärächnig nämmli uuf.
Übertragung in den St. Galler Dialekt: Erwin Messmer
 Erwin Messmer
Erwin Messmer
Nur schnell das Glück streicheln
Gedichte
Edition 8, Zürich 2017
Hardcover, 152 Seiten
ISBN: 978-3-85990-305-0
 Erwin Messmer
Erwin Messmer
Gschlaik und Gschtelaasch
Alemannische Gedichte in St. Galler Dialekt
mit vom Autor besprochener CD (Schweizerdeutsch)
Drey-Verlag, Gutach 2010
Hardcover, 88 Seiten
ISBN: 978-3-933765-54-3

Unser »Jubiläumsblog #25« wird Ihnen von Franziska Röchter präsentiert. Die deutsche Autorin mit österreichischen Wurzeln arbeitet in den Bereichen Poesie, Prosa und Kulturjournalismus. Daneben organisiert sie Lesungen und Veranstaltungen. Im Jahr 2012 gründete Röchter den chiliverlag in Verl (NRW). Von ihr erschienen mehrere Gedichtbände, u. a. »hummeln im hintern«. Ihr letzer Lyrikband mit dem Titel »am puls« erschien 2015 im Geest-Verlag. 2011 gewann sie den Lyrikpreis »Hochstadter Stier«. Sie war außerdem Finalistin bei diversen Poetry-Slams und ist im Vorstand der Gesellschaft für
zeitgenössische Lyrik. Franziska Röchter betreute bereits 2012 an dieser Stelle den Jubiläumsblog anlässlich des »Internationalen Gipfeltreffens der Poesie« zum 20. Geburtstag von DAS GEDICHT.