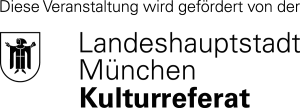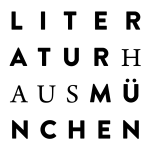Seit 25 Jahren begleitet die Zeitschrift DAS GEDICHT kontinuierlich die Entwicklung der zeitgenössischen Lyrik. Bis heute ediert sie ihr Gründer und Verleger Anton G. Leitner mit wechselnden Mitherausgebern wie Friedrich Ani, Kerstin Hensel, Fitzgerald Kusz und Matthias Politycki. Am 25. Oktober 2017 lädt DAS GEDICHT zu einer öffentlichen Geburtstagslesung mit 60 Poeten aus vier Generationen und zwölf Nationen ins Literaturhaus München ein. In ihrer Porträtreihe stellt Jubiläumsbloggerin Franziska Röchter jeden Tag die Teilnehmer dieser Veranstaltung vor.
Sie bezeichnet sich selbst als Leise- & Nachtreter, der sehr wenig zu sagen habe, und lässt lieber ihre Texte sprechen. Zum Glück redete Nancy Hünger mit Franziska Röchter dann aber doch ausführlicher: über das Hinterfragen von Kunst, die Intimität von Gedichten und über die große Unduldsamkeit einer poetischen Existenz.
Als Schreiberling will ich im Grenzland wildern & sehen wie weit der Rhythmus einen Text trägt.
Liebe Nancy, Ihr neuester Band »Ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett« (Edition AZUR, Dresden 2017) ist bereits Ihr fünfter Band in diesem Verlag, aber seit acht Jahren der erste, der ausschließlich Gedichte enthält. Wie kommt‘s?
Da kann ich nur mutmaßen? Der Gegenstand sucht ja immer die ihm gemäße Form (& vice versa), wahrscheinlich wollte sich nichts in epischen Längen ausplappern (in mir), will sagen: es ist keine bewusste Entscheidung, ehedem will ich nicht zwischen den Gattungen unterscheiden, das ist mir allmählich lästig, diese Schubladisierung der Literatur, Lyrik hier (ach, kurz), Prosa da (ach, lang), mich interessiert das Grenzland, als Schreiberling will ich im Grenzland wildern & sehen wie weit der Rhythmus einen Text trägt, tragen kann, wieviel Atem, es ist der Atem des Textes, ich will wissen, wie lange mein Atem mit ihm mithält, mithalten kann.
Wiewohl, mir liegt das Geschichten erzählen nicht, ich kann’s nicht & denke, Geschichten haben wir reichlich, auch gute, das können andere besser, überdies erzählt uns das eigene Leben bis zum Tode maßlos Geschichten an den Leib, aber Rhythmus und Textatem, so ein Näheverhältnis zur Musik & damit ein Vorschein auf das Unmittelbare: wie wunderbar. Aber nun, ich schweife. Es ist reiner Zufall, dass es ›nur‹ erkennbare Gedichte sind oder vielmehr: es ist kein Zufall, denn ich spreche in Gedichten, nur sind diese eben kürzer, erkennbar & tragen ihre Gattungs-Normen brav huckepack: so: Zeilenumbrüche, Binnenreime, Verse, Strophen, alles deklinierbar. Ein Zufall, nicht mehr.

Ich will lieber fragen, fragen müssen angesichts eines Kunstwerkes.
Sie studierten ja Freie Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar. Warum sind Sie nach dem Studium nicht dabei geblieben? Haben Sie sich mittlerweile von der Kunst entfernt?
Ich bin der Kunst schon während des Studiums davongelaufen, zumindest als ›Produzentin‹ und in die Theorie, sprich Ästhetik, abgewandert. Was so nah zu liegen scheint, verhält sich realiter recht antipodisch. Es stimmt sehr wohl, dass Vögel keine guten Ornithologen abgeben. Nun, die Abwanderung hat vielerlei Gründe, eine ganze Grundverkettung liegt im Voraus, das habe ich im Besonderen Roger Behrens zu danken, der meine kleine klapprige Denkmaschine mächtig ins Straucheln brachte und mir das Denken in unhinterfragten Selbstverständlichkeiten versuchte auszutreiben. Was schlicht bedeutete: auch das Existenzrecht der Kunst infrage zu stellen, nicht nur einzelner Werke oder gar der eigenen stümpernden Versuche. Ein weiterer Grund, der mit Roger in enger geistiger Verbindung steht, ist sicher, dass ich meine künstlerischen Stümpereien zu schnell ans Ende denken konnte, auch was damals um mich herumwuchs, schien mir ganz & gar & komplett überflüssig. Ich konnte mir also keinerlei Rechtfertigung für mein Tun herleiten. Allerdings hatte ich eine diffuse Ahnung, was ich an diesen Werken schmerzlich vermisste, was ich suchte & mir die Antworten von der Theorie erhofft: z. B. das Nichtidentische oder die Aura oder phasmes usw. usf. Die Antworten sind mir längst unwichtig, ich will lieber fragen, fragen müssen angesichts eines Kunstwerkes, was mir sehr selten noch in der bildenden Kunst widerfährt (was durchaus an mir liegen kann, meint, dass ich vielleicht unverständig für diese Sprache geworden bin), hingegen die Poesie mir, der Lesenden, diese Grunderschütterungen ständig ermöglicht, mich infrage stellt. Ich habe also nur von Kunst zu Kunst gewechselt bzw. von einer Sprache in eine andere.
Ohne Verlag wär ich nix, kein Buch, kein gar nix.
Sie arbeiten offiziell bei der Edition AZUR, Ihrem Stammverlag. Welche Funktionen üben Sie dort aus?
Sie beziehen sich sicherlich auf den Eintrag in der »Fratzen-Kladde« (so W. Droste). Nein, in dem ›klassischen Sinne‹ bzw. in einem Angestelltenverhältnis stehe ich nicht mit dem Verlag. Obwohl dies auch ein interessanter Gegenstand wäre: Was für ein Verhältnis sich da entspinnt, wie Verleger und Verlegte sich zueinander verhalten, sprich: die Frage nach hierarchischen Ordnungen, familienähnlichen Strukturen, seltsamen Abhängigkeitsgefällen?
Seis drum. Nein, ich streue den Verlagsnamen gerne überall ein, da es ein großartiger Verlag ist, quasi eine zweite Heimat für all meine ungezählten Obdachlosigkeiten & eine erste für meine kleinen Lause-Poeme. Ohne Verlag wär ich nix, kein Buch, kein gar nix, so einfach. Ich habe also dem Mut & dem erschütternden Idealismus meines Verlegers alles zu danken, denn es ist tatsächlich so, dass er an mich glaubt, wo ich doch längst vom Glauben abgefallen bin, will sagen: an mich und meine Texte, die mir schnell sehr schwächlich auf der poetischen Brust erscheinen bzw. fokussiere ich mich radikal auf die Sollbruchstellen, Fehlnoten, auf alles, was nicht gelungen ist, & sehe vor lauter Zweifel den Text nicht mehr. Er kann das Poem hinter den Zweifeln sehen & darauf vertraue ich, ich vertraue ihm also wortwörtlich: blind.
Relevant ist, was das Gedicht dem Leser zu sagen hat.
Beim erstmaligen Lesen des Titels Ihres neuen Gedichtbandes musste ich sofort an den allerletzten Abschied eines Menschen, nämlich den von diesem Planeten, denken. So wird es wohl nicht gemeint sein, jüngere Leser haben sicherlich andere Assoziationen?
Lassen wir die Assoziationen ruhig laufen & tändeln. Was ich meine, zu sagen zu haben, ist irrelevant. Relevant ist, was das Gedicht dem Leser zu sagen hat, ob es überhaupt mit ihm spricht. Ach, ich hoffe, lieb Gedicht, sprich.
Sind Gedichte nicht auch ein sehr intimes Zwiegespräch, manchmal über Äonen hinweg, ein Gespräch, dass nicht abreißt, nicht abreißen darf?
Im ersten Kapitel »Liederliche Lieben« widmen Sie jedes Gedicht einer jeweils anderen bestimmten Person. Als Leser bleibt man etwas außen vor, man kann natürlich nicht immer nachvollziehen, welche Anspielungen sich worauf beziehen, wer gemeint ist, es sind teilweise intime Gedichte. Letztendlich wirken sie auf mich wie öffentliche Briefe, wie etwas, das Sie diesen adressierten Personen immer schon einmal sagen wollten …
Die Widmung: eine verzwickt verzwackte Angelegenheit, dies. Ich las just bei Connie Palmen, dass sie ausschließliche, also Ein-Personen-Widmungen ablehne, weil diese sie dem Text entfremden, ihr gleich zu Beginn den Text unwiederbringlich entziehen, ihr die Türe feist vor der Lesenase zuschlagen. Das ist eine radikale Position, der ich viel abgewinnen kann & zugleich waren die Widmungen m. E. existentiell notwendig, weil die Texte ihre Herkunft ganz konkreten Adressaten oder erschütternden Lektüren verdanken, ohne diese Begegnungen, ob dies- oder jenseits, wären diese Gedichte nicht entstanden. & was hat man denn als Dichter großartig zu geben, außer Gedichte. Sind Gedichte nicht auch ein sehr intimes Zwiegespräch, manchmal über Äonen hinweg, ein Gespräch, dass nicht abreißt, nicht abreißen darf? & natürlich hoffte ich, dass die Texte ohne Adressat laufen lernen, deshalb die Abkürzungen, damit die Namen nicht durch die Gedichte klingeln, die Gedichte dominieren. Die Formulierung »öffentliche Briefe« umkreist das Dilemma sehr gut.
Ich glaube, ganz unverschämt & lächerlich, an die Liebe, weil man daran einfach nicht glauben kann.
Das zweite Kapitel wirkt auf mich wie eine Art Rückschau, auch aufs eigene Leben, und endet mit Ihrem bekannten titelgebenden Gedicht »Der Abschied ist gemacht«, dessen letzte Worte lauten: »ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett«. In dem Text heißt es: »glaubst du an nichts wird alles wahrscheinlich«. Woran glauben Sie, liebe Nancy?
Ich glaube, ganz unverschämt & lächerlich, an die Liebe, weil man daran einfach nicht glauben kann. Ich glaube an die Sprache, weil man daran einfach nicht glauben kann. Mein Glauben glaubt immer wider den eigenen Verstand. Ich glaube mit unerschütterlicher Vorliebe gegen die Hoffnungslosigkeiten trotzig an, gegen alles unabänderlich Aussichtslose.
Ihr fünftes Kapitel »Familiarium« zeichnet ein eher düsteres Bild von Familie, in der man zwar gemeinsam »bei Tisch« sitzt, aber im Grunde jeder für sich allein ist. Glauben Sie, dass herkömmliche Familienstrukturen ein Auslaufmodell sind?
Die Frage ist ein Schwergewicht, ach, ein wahrlich adipöses Übergewicht & ich müsste schon eine kleine Abhandlung verfassen, um auch nur rudimentär darzulegen, was ich von dieser terroristischen, teils deformierenden, ideologischen Zelle halte. Da sollte man sich lieber gleich bei Cooper oder Dr. Freud auf die Plüsch-Couch legen, bevor ich mich durch dieses Thema stümper. Die Familie ist eben dies & das zugleich, ein experimentelles Feld, bestellt zwischen Himmel & Hölle.
Was ich zu sagen habe findet sich in meinen Texten.
Nach dem Lesen Ihres Textes »NIX DA!« denke ich: Was darf ich eine Nancy Hünger zu ihren Texten fragen?
Wir haben doch bereits eine beachtliche Menge Fragen, auf die ich artig (& für meine Verhältnisse recht freiwörterig) versuchte zu antworten. Ich weiß es nicht, es vollzieht sich vielmehr ex negativo: Wenn ich eine Frage höre, weiß ich, ob Sie mir unangenehm ist oder nicht. & ja, die meisten verursachen bei mir eine arge Malaise. Mir ist einfach schleierhaft, was man von diesen privatimen, handwarmen Auskünften aus der klapprigen Seelenbude eines Schriftstellers erwartet? Was ich zu sagen habe, falls ich überhaupt etwas zu sagen habe, findet sich in meinen Texten, das umgreift auch die Form, ich kann es nur auf diese Weise sagen, der Rest wäre / ist halb gare Redundanz, ich plapperte mir selbst nach, ein alter zauseliger Papagei, eine Persiflage.
Sie beschwören das ›Geheimnis‹ in der Dichtkunst herauf, nicht die öffentliche Hinrichtung mittels zur Schau gestellter Sezierung von Texten, speziell Gedichten. Generell scheint es, als sei Ihnen das ganze Gewese ums Schreiben, das Erhöhen von Schreibern, eher zuwider. Welchen Rat würden Sie sogenannten Kritikern, Kulturjournalisten geben?
Ich habe leider wirklich keinen Rat zur Hand & verweise auf die vorherige Antwort.
Wie sehen Sie die bisherigen Versuche der ›Lyrikvermittlung‹ im Deutschunterricht an öffentlichen Schulen, im Schulunterricht? Müsste sich da nicht auch ganz viel ändern?
Alles, schlichtweg alles, zumindest was die Lyrikvermittlung anbelangt. Ein weites, weites Feld, zu weit für diesen Fragekatalog & meine begrenzten Auskunftskräfte. Bitte verzeihen Sie, liebe Franziska, das besprechen wir lieber im angeschlagenen Neonlicht irgendeiner traurigen Schulcafete in der östlichen Provinz.
Jedoch habe ich bei den gestrengen Lyrik-Interpretationen jämmerlich versagt.
Waren Sie eine gute (Deutsch-)Schülerin?
Teilweise, weil ich eine großartige Deutschlehrerin hatte. Eines dieser ganz raren Exemplare, das tatsächlich von einer existentiellen Liebe zur Literatur in die Lehrerschaft getrieben wurde. Allerdings war ich, wenn ich den Noten einmal Glauben schenken will, nur in den freien Disziplinen »gut«, z. B. Essay. Jedoch habe ich bei den gestrengen Lyrik-Interpretationen jämmerlich versagt. Was meine Lehrerin damals als persönlichen Affront interpretiert wissen wollte. Ach Karin, verzeih. Oskar Loerke hat mir die Note gebrochen.
Na & über Sport wollen wir lieber gar nicht erst sprechen. Ansonsten mäßig, ich tat, was man tun musste & geriet nur in Eifer & Überschwange, wenn mich etwas gänzlich entzünden, beanspruchen, meine Aufmerksamkeit fokussieren konnte.
Ja, Iryna, man kann bloßlegen das Metrum, das Geschlecht, die Zäsuren
stiftenden Kommata, Bindestrich und Punkt, man kann es entblößen
das Sprachleibchen bis auf die dünnen syntaktischen Knöchelchen.
finis. Man kann Listen durchwildern, Tagebücher, Reden, die
biographischen Einerleien herbeirufen und einen Hölderlin von Scardanelli
zu unterscheiden wissen. Man kann das Anekdotische den
Gedichten auf- oder abschwatzen. Nimm doch Paule, Iryna, die Kenner
sagen Ancel, die Kenner kennen sich aus und schlagen sich mit
der Machete des Allwissens durchs unwegsame Genesisgelände und wissen
wie lang er im Gitterbettchen auf Jahr und Tag und Stunde genau. Was
wissen dann aber die Kenner von Paules Gedichten? Sie kochen das
Gold zu Rede, zu schwänzelndem geschwätzigen Regengewürm.
Auszug aus: Nancy Hünger: »Binnen Goldspur Liebe schweig« (erscheint demnächst in der Thüringer Literaturzeitschrift »Palmbaum«)
»Schriftsteller waren und sind jene, die Untertage kriechen, in den Dunkelgrund der Sprache, um unter widrigen Bedingungen vergebliche Kerben in eine unbeleuchtete Ewigkeit zu kratzen, während die Kanari tot in den Käfigen wesen und die Grubenlampen allmählich erlöschen«, heißt es in Ihrer Rede im Juni 2015 bei der Übergabe des Thüringer Literaturstipendium Harald Gerlach. Ihre Meinung über die schreibende Zunft ist nicht gerade hoffnungsvoll …
Übertreibung ist ein probates Mittel, um die Aufmerksamkeit ein wenig zu justieren. Allerdings häuften sich über die Jahre die traurigen Biographien, die jäh abgebrochenen Schreib- oder schlimmer Lebenslinien von Freunden & Kollegen. Besehen wir es einmal genau, so war jenen, die die Sprache voran oder auch an die Grenzen trieben, zu Lebzeiten wenig Komfort beschieden. Ich sage nur Hilbig, sage Zieger usw., die Liste ist lang und sie liest sich wie eine traurige Totenklage, das ist schon alles. Ich spreche also nicht für mich Leise- & Nachtreter, ich spreche für die Vorausgegangenen & ja, ja, es ist eine alte Leier, aber das bedeutet nicht, dass wir bis in alle Ewigkeit auf dieser Leier spielen müssen.
Die poetische Existenz ist unduldsam gegen alle äußeren Störungen.
In eben dieser Rede beschreiben Sie die Existenz, die Sie nach der Veröffentlichung Ihres ersten Lyrikbandes betreten haben, die »poetische Existenz«, als gnadenloses und einnehmendes Wesen: »die poetische Existenz, die eine Sprachexistenz, eine reine Wortexistenz ist, unduldsam gegen alle äußeren Störungen, sogar gegen die Liebsten, die Freunde, die Familie sich richtet, gegen runde Geburtstage, Taufen oder Erstkommunion, ein lautes Arbeitsveto einlegt, rücksichtslos, uneinsichtig gegen alle lebensverlängernden und lebenspraktischen Maßnahmen vorgeht.« Wie umfangreich sind denn Ihre »äußeren Störungen«, Ihre »lebenspraktischen Maßnahmen«, oder haben Sie sich mittlerweile komplett assimiliert?
Die Störungen sind vielfältig & zumindest störend genug, um ins Straucheln & Grübeln oder in Missmut zu geraten. Es gibt die innerbetrieblichen, die familiären, die literarischen & notwendig existentiellen. Man vernachlässigt immer eine Seite, zu Ungunsten der anderen. Es ist eine elende Jonglage zwischen Freiheit & Unfreiheit & Notwendigkeit, die schnell in etliche Dilemmata führen kann & schon fühlt man sich wie Buridans Esel, der vor lauter Heu verhungern muss.
Ich jongliere weiterhin & versuche mich im Zwischenreich bestmöglich einzurichten.
Und ebenfalls köstlich beschreiben Sie auch die Notwendigkeiten innerhalb einer derzeit mehr als 10 Jahre andauernden poetischen Existenz, die bei Ihnen durch den Erhalt dieses Thüringer Literaturstipendiums vorübergehend abgefedert wurde: »Dass diese Arbeit, die tatsächlich Arbeit im emphatischen Sinne lohnenswert ist, steht außer Frage, aber sie lohnt leider nicht. Also legt man sich einen Zweit-, Dritt- und manchmal auch Viertjob zu, um den Notstand, das lebensnotwendige Minimum aufrecht zu erhalten …« Wie kann dieses generelle Dilemma von Kunstschaffenden gelöst, zumindest verbessert werden? Wie haben Sie, die Sie ja sagten, die Literatur dulde nichts neben sich, es gelöst?
Ich habe nichts gelöst, nichts lösen können, ich jongliere weiterhin & versuche mich im Zwischenreich bestmöglich einzurichten & die Gegebenheiten mit einem Mindestmaß an Stoizismus zu akzeptieren. Ich habe Glück, dass ich in Schillers Gartenhaus mein Ausgedinge habe & somit ›grundversorgt‹ bin, indem ich z. B. Dichter einladen kann, ich habe Pech, weil dies ein schönes Ausgedinge ist & ich mich nicht allein darauf konzentrieren kann, manches vernachlässige, weil die Sprache nach mir ruft, mich regelrecht an den Haaren zerrt, gestreng herbeizitiert & wenn ich nicht folge, folgt das Leid. Man muss also ständig das Dunkeltier Gewissen zu besänftigen suchen, so gut man eben kann.
Wie man nun das generelle Dilemma lösen kann, werden wir vielleicht erfahren, wenn das Haus für Poesie wieder einmal tagt, das momentan allerlei Anstrengungen auf sich nimmt, um über diese Fragen zu diskutieren & eventuell Lösungswege zu finden. Es ist schwierig, dies Thema, denn auch damit verbinden sich unzählige andere Fragestellung z. B. jene der Autonomie usw.
Das Schreiben, die Sprache verlangt viel, fordert viel, relativiert alles.
In Ihrer »Schlegel-Rede«, Ihren Dankesworten 2014 bei der Verleihung des Caroline-Schlegel-Förderpreises, bedanken Sie sich beim Publikum für die »Würdigung eines weiteren Scheiterauftrages« und beschwören die Kunst des immer besseren Scheiterns anhand eines »fallsüchtigen Velozipedisten« herauf. Sie schildern, wie es ist, »die scheinbar gesicherte Basis einer wohlfeilen Existenz aufzugeben, für ein gänzlich ungesichertes, zuweilen auch lebensbedrohliches Terrain, ohne doppelten Boden oder Reißleine, ohne Aussicht auf Erfolg.« Ist das, trotz all Ihrer Erfolge, Ihre Auffassung oder Vorstellung von der poetischen, von der schriftstellerischen Existenz? Was genau meinen Sie mit »lebensbedrohlichem Terrain«?
Auch hier schließe ich die Vorausgegangen in meinen SingSang ein, will an sie erinnern. Was habe ich schon auszustehen, angesichts ihrer großen Zerwürfnisse. Aber ich meine, zumindest begriffen zu haben, das Schreiben, die Sprache verlangt viel, fordert viel, relativiert alles, oft auch zuungunsten der eigenen Biografie oder der Liebsten, man ist ja nicht allein betroffen, schlimm genug, man betrifft andere. Es ist ein einsames Geschäft & ich kann mich nur wiederholen, es duldet wenig neben sich. Darauf muss man sich einlassen oder nicht, Bangemachen gilt nicht, gewiss, man hat uns nichts versprochen!
Leseprobe aus:
NIX DA!
An dieser Stelle, gewiss ist es auch schon zu spät, bin ich mir selbst ganz scheinheilig,
meinen eigenen Abneigungen aufgesessen, weil ich eigentlich nur zwei Worte schreiben wollte, zwei Worte zu diesem warum, weshalb, woher und vor allem wie: SO EBEN oder GENAU DESHALB oder MEHR NICHT oder einfach NIX DA, weil ich nun aber den Versuch wage unter Auslassung der Rezepte und Gebrauchsanweisungen unter Auslassung der Anleitung: des WIE DENN NUN ALSO GENAU?; und wenn es nur eine akrobatische, eine poetische Annäherung ist.
Wie es also vonstattengeht, will man wissen, ich meine, es ist der innere Kommentator, eine Krankheit, eine Berufskrankheit, eine angerufene Krankheit, dass da eine Stimme im Kopf vorherrschend ist, die zugleich simultan übersetzt, die ganze Wahrnehmung simultan übersetzt und nicht Ruhe gibt, also alles geht mir in Worten auf, nichts wird hingenommen, nichts kann hingenommen werden wie es ist oder wie es sei, wie es mir in einem bestimmten Moment erscheint, alles muss in Relation und Verhältnisse gesetzt werden, in Sprache, in einer künstlichen Sprache – wohlgemerkt – aufgehen, das ist ein anhaltendes Zittern der Nerven, ein ständiges Geplapper (so ein Rauschen, so ein Geräusche) im Kopf, dem man nachgeben, dem man sich ab einem gewissen Punkt wohl ausliefern muss (dem Klang des Denkens, so B.O.), weil man begreift, dass das leichtfertige Begreifen, ein Begreifen ad hoc oder die sog. plötzliche quasi Gewissheit nun endgültig vorbei ist, weil man meint, alles stehe für etwas ein, und dieses für etwas gelte es zu ergründen, weil es nun keine Sonne mehr gibt und keine Bäume und keine Wolken, also das einfachste Zeug ist dahin, das einfachste Zeug ist immer nur für etwas eine innere Chiffre usw., und man beginnt zu deuten, eine Arbeit am Text, es beginnt die Textwerdung, wenn man die Chiffre entschlüsseln, wenn man sich die Einfachheit zurückerobern, freischaufeln will. Die Sache mit der Rose, die eine Rose ist usw.
Überhaupt, so meine ich, ist der Vergleich zur Archäologie der einzig Taugliche in diesem ganzen Diskurstralala, in dieser ganzen poetologischen Nabelschau, das einzige was noch gesagt werden sollte, und sicher kamen viele bereits auf diesen taghellen, einzig tauglichen Gedanken, den es noch hinzuzufügen gilt, mit dem es die ganzen Floskeln von Weltsprache und Ursprache und Existenzsprache und Liebessprache und Weltmusik – letztlich Volksmusik – zu entlasten gilt. Es ist also eine Grabungstätigkeit, ein Freischaufeln in vielerlei Hinsicht, ein Freilegen und Archivieren und Ordnen und Sammeln der aufdrängenden, der aufgedrängelten Eindrücke, der hereinstürzenden Welt, und noch einmal ein Freischaufeln der Versprachlichung, das Leichtsagbare, die allererste Wendung muss weggekratzt, ausgekratzt werden aus dem Nervenkostüm, das ja auch an einer permanenten Alltagsversprachlichung klebt, dem permanenten Alltagsgeplapper auf
dem Leim geht, diese Alltagsrudimente, Sprachhülsen, wir sagen Floskeln, sagen
Klischees, das Erst- und Leichtsagbare muss also abgeschürft werden, um auf etwas tiefer gelegenes zu gelangen, auf etwas, das wesentlich scheint. Aber all das ist nur eine Vermutung.
© Nancy Hünger
 Nancy Hünger
Nancy Hünger
Ein wenig Musik zum Abschied wäre trotzdem nett
Gedichte
edition AZUR, Dresden 2017
Softcover, 118 Seiten
ISBN: 978-3-942375-28-3

Unser »Jubiläumsblog #25« wird Ihnen von Franziska Röchter präsentiert. Die deutsche Autorin mit österreichischen Wurzeln arbeitet in den Bereichen Poesie, Prosa und Kulturjournalismus. Daneben organisiert sie Lesungen und Veranstaltungen. Im Jahr 2012 gründete Röchter den chiliverlag in Verl (NRW). Von ihr erschienen mehrere Gedichtbände, u. a. »hummeln im hintern«. Ihr letzer Lyrikband mit dem Titel »am puls« erschien 2015 im Geest-Verlag. 2011 gewann sie den Lyrikpreis »Hochstadter Stier«. Sie war außerdem Finalistin bei diversen Poetry-Slams und ist im Vorstand der Gesellschaft für
zeitgenössische Lyrik. Franziska Röchter betreute bereits 2012 an dieser Stelle den Jubiläumsblog anlässlich des »Internationalen Gipfeltreffens der Poesie« zum 20. Geburtstag von DAS GEDICHT.