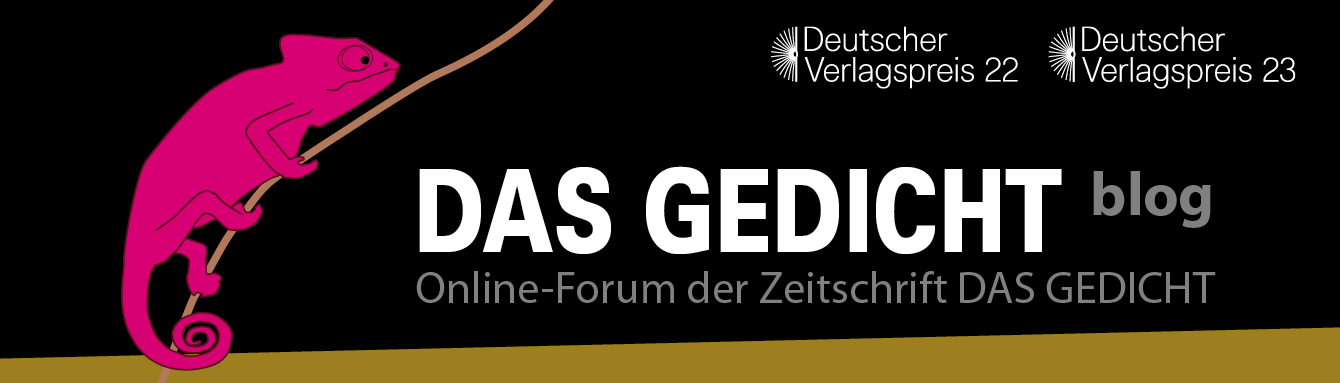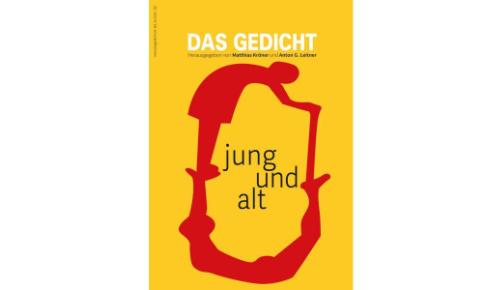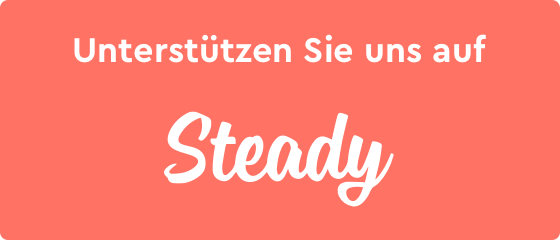Achim Raven veröffentlicht jeden zweiten Monat am 13. Überlegungen zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Gedichteschreibens.
Sprache ist, was der Normalfall ist. Normal ist, wenn alle so reden, wie ihnen der Schnabel wachsen durfte. Damit das klappt, ist es aber auch normal, dass die Schnäbel Themen und Regeln folgen. Die werden nicht diktatorisch erlassen und auch nicht von einem weisen Gremium beschlossen, sie entstehen aus und mit dem, was aus den Schnäbeln immer so rauskommt. Die Betätigung der Schnäbel hat ja den Zweck, verstehbar zu sein, und das würde ohne Themen und Regeln genauso scheitern wie die Themen und Regeln ohne das Auf- und Zuklappen der Schnäbel. Der Normalfall ist ein individuelles Vermögen, das der individuellen Willkür entzogen ist, indem Quantität in Qualität umschlägt – die Häufigkeit bestimmter Anwendungen wird zum Normalfall. Ganz schön vertrackt.
Noch vertrackter wird der Normalfall durch den verständlichen Wunsch, mit Hilfe der Themen und Regeln Eindeutigkeit herzustellen. Das gelingt selten, eigentlich nur in Definitionen, amtlichen Verlautbarungen oder Kochrezepten. Und selbst da kann der Wunsch ins Desaster führen: Tautologien, Amtssprache, das Zeug wird nicht gar …
Aber der Wunsch nach Eindeutigkeit wäre ja auch kein Wunsch, wenn die Eindeutigkeit zum Normalfall dazugehören würde. Man wünscht sich ja nur, was einem fehlt. Normal ist – wie Karl Kraus 1911 feststellt – vielmehr:
Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück.
(Karl Kraus, Die Fackel 326-328, S. 44)
Keine 60 Jahre später macht Alexander Kluge die Probe aufs Exempel:
Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. DEUTSCHLAND.
(Alexander Kluge, Die Patriotin Texte/Bilder 1-6, Frankfurt am Main 1976, S. 129)
Man stelle sich dieses Wort in den Köpfen eines Fußballfans, einer polnischen Fernfahrerin, eines Statistikers, einer chinesischen Kuckucksuhrensammlerin, eines Salafisten, einer AfD-Politikerin, eines Bürgergeldempfängers, einer erfolgreichen Unternehmerin und eines Investigativjournalisten vor, die dann auch noch über DEUTSCHLAND miteinander zu reden anfangen. Da prallen nicht nur die unterschiedlichsten Bedeutungen aufeinander, diese Bedeutungen bilden auch noch Interferenzen, neue Bedeutungsvarianten entstehen sowie Missverständnisse und Unterstellungen. Statt Eindeutigkeiten herrschen assoziative Cluster. Konfusion ist unvermeidlich, spätestens wenn aus den Wörtern Sätze werden.
Immerhin schließt das illusionäre Streben nach Eindeutigkeit ein humanes Miteinander nicht aus, solange es einen Common Sense zulässt. Herstellen kann dieses Streben das humane Miteinander aber nicht, zu durchlässig ist die Membran zwischen Common Sense und Ideologie: Wo die freie Meinung endet und das sich als Meinung gerierende Geplapper anfängt, ist oft schwer auszumachen.
Als Plappersprache bezeichne ich eine Sprache, in der Benennen, Beschreiben und Erklären, damit Verstehen, nicht Zweck der Äußerung sind, sondern Mittel, mit dem Sprecher*innen sich selbst oder anderen etwas beweisen wollen, etwa Zugehörigkeit, Distinktion oder Überlegenheit.
(Achim Raven, Plappern – Macht – Schule, Düsseldorf 2017, S. 19)
Im Gegensatz zu dem Aberglauben, noch das haltloseste Gewäsch, Geplapper eben, sei Meinung und habe vorbehaltlos respektiert zu werden, ist wirkliche Meinung ein ungesichertes, vorläufiges Wissen auf Grundlage der Bereitschaft, sich von triftigen Argumenten überzeugen zu lassen. Die Grenze zwischen Meinung und Geplapper verläuft zwischen Sätzen wie: »Am Strand sehe ich doch immer, dass die Erde eine Scheibe ist. Was spricht denn dagegen?« und »Dass die Erde eine Scheibe ist, ist für jemand wie dich natürlich nicht nachvollziehbar. Es ist aber meine Meinung, und die lasse ich mir von dir nicht kaputtmachen.«
Das Geplapper als Selbstüberhöhung durch Herabsetzung anderer ist das Grundrauschen der Konkurrenz, die ja bekanntlich das Geschäft belebt und zur DNA unserer Gesellschaft gehört. Gerade die Plappersprache strebt nach Sprachbeherrschung, obwohl – oder gerade weil – ihr es nicht selten am Notwendigsten gebricht: semantisch und logisch belastbare Zusammenhänge herzustellen. Sprachbeherrschung will für Recht und Ordnung sorgen. In der Plappersprache herrscht jedoch das Faustrecht: Wer verbal am heftigsten zuschlägt, hat Recht. Flankiert wird dieses Faustrecht durch sprachpolizeiliche Maßnahmen mit dem Duden als Feldspaten, deren Zweck darin besteht, die andere Seite zur Strecke zu bringen. Da es in der Sprache keine Gewaltenteilung gibt, ist die Sprachpolizei in Wirklichkeit eine Bürgerwehr mit angemaßten Rechten, deren Maßnahmen (Niederbrüllen, endlose Beispiel- und Gegenbeispielgirlanden, Moralisieren etc.) mit dem sprachlichen Faustrecht letztlich in eins fallen: Es geht um blanke Rechthaberei.
Diese Rechthaberei ist kein psychischer oder moralischer Defekt, sondern ein sozialer. Dem Bourgeois ist der Citoyen abhandengekommen, die partikularisierten Einzelnen sehen in sozialen Prozessen nur noch Schaltzentralen, Strippenzieher, Machenschaften und Machinationen am Werk. Sie glauben an die große Manipulation, der auch die Sprache dient. Und dieser Glaube versetzt Berge, denn er macht die Sprachmanipulation überhaupt erst möglich. Dass Sprache aus und mit dem Kollektiv aller Sprechenden entsteht, in dem also, was aus allen Schnäbeln rauskommt, liegt für sie jenseits des Vorstellbaren. Ihre Sicht ist zwar äußerst borniert, aber für sie eben auch, so scheint es zumindest, höchst nützlich.
Genau an dieser Stelle erweist sich die Bedeutung der Lyrik. Deren Material ist der sprachliche Normalfall: semantische Mehrdeutigkeit und Indifferenz mitten in einem undurchdringlichen Dschungel aus Themen und Regeln. Sie ist unnütz, und sie ist eben nicht borniert: Sie produziert Luxusprodukte. Luxus (wörtl: Überfluss) dient ja gemeinhin als Distinktionsmittel, also um damit zu prahlen, was man sich alles leisten kann, das andere sich nicht leisten können, z. B. Lamborghinis, Prada-Handtaschen, gute oder schlechte Manieren, guter Geschmack. Jenseits aller Prahlerei deutet Luxus aber auch noch auf die Vorstellung hin, dass es ein Leben geben könnte, das mehr ist als bloßes Überleben, die prekäre Absicherung von Leib und Leben mit dem Notwendigsten. Verständlicherweise haben die Freund:innen jenes exklusiven Luxus für diesen inklusiven Luxus buchstäblich nichts übrig und freuen sich, wenn anderen Verzicht gepredigt wird.
Lyrik ist Luxus. Für manche ein exklusiver Luxus, mit dem sich guter Geschmack und subtile Kennerschaft demonstrieren lassen. Dieses Publikum kennt man und überlässt es gern der Trostlosigkeit des Bescheidwissens. Hierum kümmert man sich nicht. Lieber wendet man sich dem inklusiven Luxus zu, den Sprachgebilden, die zu nichts nutze sowie in Gefahr und höchster Not sogar ein Ballast sind (und kein Trost, wie bildungsbürgerliche Ideologen immer noch behaupten – Hölderlin im Schützengraben u. dgl.). Der inklusive Luxus der Lyrik besteht erstens darin, dass sie immer dann zugänglich ist, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Zweitens darin, dass sie offenbart, was Sprache (und damit strukturiertes Denken) jenseits von Strategien und Machtspielen sein kann. Und drittens schließlich darin, dass zwar sie nichts beibringt und niemanden erzieht, dafür aber das Lesen lehrt. Wer Gedichte versteht, wird auch von ihnen verstanden: Wenn ich etwas über ein Gedicht sage, sagt es auch etwas über mich.
Ein schönes Beispiel für diese wunderbare Nichtsnutzigkeit der Lyrik:
Ein Bild aus Reichenau
Auf einer Blume, roth und brennend, saß
Ein Schmetterling, der ihren Honig sog,
Und sich in seine Wollust so vergaß,
Daß er vor mir nicht einmal weiter flog.
Ich wollte seh’n, wie süß die Blume war,
Und brach sie ab: er blieb an seinem Ort;
Ich flocht sie der Geliebten in das Haar:
Er sog, wie aufgelös’t in Wonne, fort!
(Friedrich Hebbel, Ein Bild aus Reichenau, Sämtliche Werke. 1. Abteilung: Werke, Berlin 1911 ff., S. 230.)
Der Titel legt nahe, dass es sich um die Darstellung eines flüchtigen Moments an einem Sommertag in Reichenau an der Rax handelt, der Sommerfrische des Wiener Großbürgertums. Es ist wohl auch so, aber allein deswegen wäre das Ganze nur ein Ankedötchen aus dem Leben eines gewissen Herrn Hebbel. Die eigenwillige Wortwahl lässt jedoch aufmerken: Eine Blume kann roth sein, feuerrot sogar, aber sie kann eigentlich nicht roth und brennend sein. Brennend kann Verlangen sein, das in dem Gedicht offensichtlich eine Rolle spielt, das aber wiederum nicht roth sein kann. Dennoch stehen Farbe, Verlangen und Hitze hier in enger Beziehung, sie bilden einen allegorischen Kontext, zu dem dann auch die Blume (als passiv Reizendes) und der Schmetterling (unstet suchend, dem Lustprinzip folgend) passen.
Hier fügt sich auch der Honig-Topos ein, bekannt durch den Honigmond und eventuell auch durch Slim Harpo, der in I’m A King Bee von einem Bienenkönig singt, also von einer Drohne, die um den Stock der Angebeteten scharwenzelt und in der Hoffnung, hereingelassen zu werden, damit prahlt, dass er mächtig »Honig machen« kann. Mit seiner dubiosen Männerphantasie stellt Slim Harpo zwar alle natürlichen Zusammenhänge auf den Kopf, macht aber auch genau das, was Dichter:innen etwa machen: Böhmen ans Meer verlegen.
Am Ende von Hebbels erster Strophe übertäubt der Rausch des Nektarsaugens sogar den Fluchtreflex. Dies ist bereits angekündigt in der Verbindung von »sich vergessen« mit dem Akkusativ statt dem Dativ, der dem Vergessen zusätzlich eine Zielrichtung unterstellt, ähnlich dem Austriazismus »daran vergessen«.
Die zweite Strophe setzt das Spiel mit sexuellen Konnotationen auf frivole Weise fort. Der Bürger, der sich dem wollüstigen Rausch des Honigsaugens versagen muss, will wenigstens seh’n, wie süß die Blume ist. Das widerspricht zwar der Sprachlogik, offenbart darin aber gerade die Gewalt der Konvention, die einen sexuellen Impuls in Voyeurismus umlenkt. Im Gegensatz dazu saugt aufgelös’t in Wonne der Schmetterling immer weiter fort, selbst als die Blume ins Haar der Geliebten geflochten ist. Was der Mann seiner Geliebten da anträgt, überschreitet alle Grenzen des Anstands. Dieses männliche Begehren unterscheidet sich in nichts von den weit weniger subtilen Phantasien eines Slim Harpo, auch nicht darin, dass die Angebetete eigentlich gar nichts zu melden hat.
Hebbels kleine Naturbeobachtung reagiert auf eine Sexualmoral, die nicht zulässt, sich in die Wollust zu vergessen. Er folgt dieser Konvention mit seinen Worten, weitet aber auch bei aller Behutsamkeit seiner Formulierungen die Grenzen des Erlaubten. Auch wenn das sexuelle Begehren hier immer noch Männersache bleibt, so erhebt sich doch eine Frage, die über Erotik und Sexualität hinausgeht: Könnte die Entgrenzung des Gefühls nicht doch eine Befreiung von den Zwängen sein? Könnte die Lust die Angst besiegen?
Dass dieses kleine Gedicht bei aller vordergründigen Privatheit Gesellschaftliches reflektiert, wird noch einmal klarer, wenn man sich bewusst macht, dass Hebbels Altersgenosse Richard Wagner in Tristan und Isolde genau dasselbe thematisiert. Nur mit viel mehr Brimborium und einem Todeskitsch, den Hebbel elegant umgeht, indem er den Schmetterling einfach weitermachen lässt.
[…]
Sind es Wolken
wonniger Düfte?
Wie sie schwellen,
mich umrauschen,
soll ich atmen,
soll ich lauschen?
Soll ich schlürfen,
untertauchen?
Süß in Düften
mich verhauchen?
In dem wogenden Schwall,
in dem tönenden Schall,
in des Welt-Atems
wehendem All –,
ertrinken,
versinken –,
unbewußt –,
höchste Lust!
(Richard Wagner, Die Musikdramen. Hamburg 1971, S. 383)
Friedrich Hebbel, Slim Harpo, Richard Wagner – der Entgrenzungsobsession sind keine Grenzen gesetzt. Auch Alfred Hitchcocks Vertigo handelt von so einer Entgrenzungsobsession. Nicht zufällig lässt Hitchcocks Hauskomponist Bernard Herrmann sich für den Score von Wagners Tristan-Akkord inspirieren. Dies greift wiederum Matthias Glasner für seinen Film Die fremde Frau von 2004 auf, in dem Wagners Vorspiel und Liebestod und Herrmanns Vertigo-Score nahtlos ineinander übergehen. Solche Zusammenhänge werden nicht ausgedacht, sie werden entdeckt. Durch Themen und Regeln »liegen sie in der Luft«.
Hebbels nichtsnutziges kleines Meisterwerk zeigt darüber hinaus, dass der Umbruch in die Moderne ab ca. 1880 weniger grundsätzlich ist, als es zunächst den Anschein hat. Das heißt nicht, dass dieser Umbruch mit seiner Infragestellung gesellschaftlicher, moralischer und ästhetischer Regeln nicht radikal gewesen wäre, doch wie Hebbel beweist, ist das sprachliche Spiel an den Grenzen des Erlaubten schon da, bevor die radikale Moderne jene Rat- und Hilflosigkeit selbst bei wohlmeinendsten Kunstfreund:innen hervorruft, die längst schon fällig war. Purer Luxus ist dieses nichtsnutzige kleine Meisterwerk – wäre es nicht da, niemand würde es vermissen. Aber es ist nun einmal da, und niemand ist von der Freude über die Entdeckungen ausgeschlossen, die es bereithält.
© Achim Raven, Düsseldorf