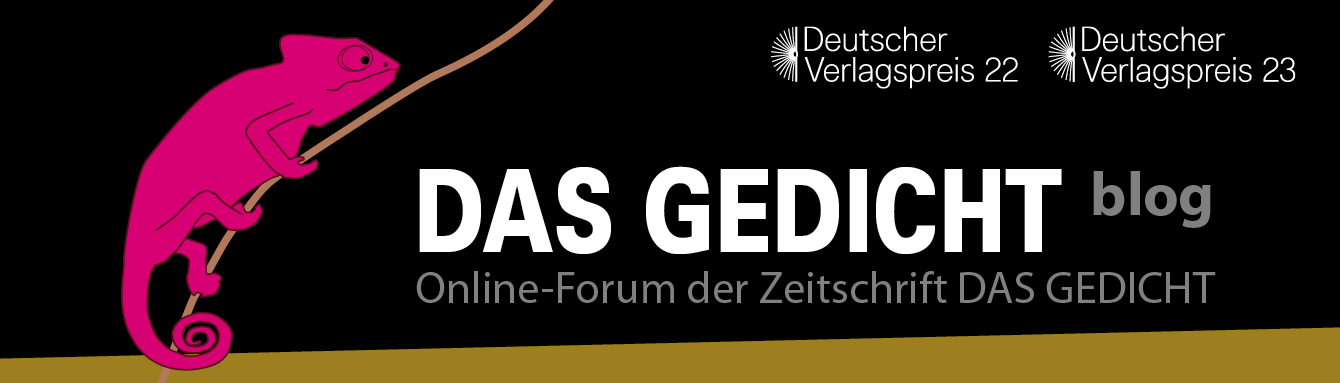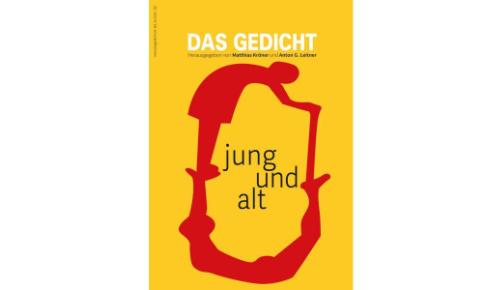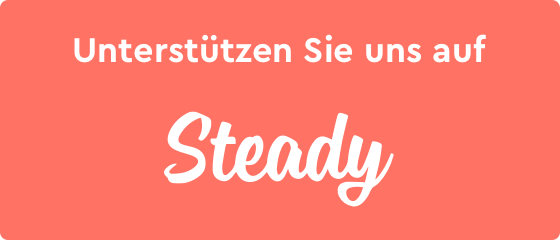Bücher können auftauchen und glänzen, aber auch einstauben und verschwinden – immer gilt jedoch, ganz gleich, wie alt sie sind: Ihre Texte wollen neuentdeckt werden! David Westphal stellt an jedem 15. des Monats Vergessenes und Neugelesenes in seiner Rubrik »Neugelesen« vor.
Was ist eigentlich aus der Lautpoesie geworden? Das frage ich nicht ob der Annahme, dass es sie nicht mehr gäbe. Und ein Massenphänomen war sie ja nie, obschon sie mittlerweile eine lange Tradition und viele Adaptionen sowie Überschneidungen erfahren hat. Eine besonders relevante Adaption hat die Lautpoesie dabei in der Musik gefunden. Ja, sie scheint mir mittlerweile dort mehr beheimatet zu sein als in der Lyrik selbst.
Die Lautpoesie verzichtet auf sprachliche Semantik. Sie bedient sich an Silben und anderen Lauten, zu denen unser Sprechapparat fähig ist. Bei Lautpoesie geht es damit eher um eine vorgetragene musikalische Komposition als um ein übliches Gedicht. So bin ich auf Lautpoesie eben auch an für mich unerwarteter Stelle gestoßen: Kürzlich war ich auf einem Konzert in München, bei dem unterschiedliche Noise-KünstlerInnen aufgetreten sind. Zwei der drei Acts standen zwar noch mit typischem Bandsetup auf der Bühne, haben aber bereits Noise, also Geräusche, als Teil ihrer Lieder eingehegt. Und einer hat sich gar dem totalen Lärm verschrieben: der Ein-Mann-Act Rumpeln.
Was ist Noise? Eine Frage, die sich Rumpeln wohl auch gestellt hat. Seine Antwort ist bestechend einfach und titelt eines seiner Alben: »Noise Means Noise«. Besser lässt es sich kaum fassen, denn das Phänomen Noise ist zu divergent, um es anders zu beschreiben. Noise-KünstlerInnen stemmen sich in jedem Fall gegen traditionelle Elemente wie Strukturen, Melodien und regelmäßige Rhythmen. Was nicht heißt, dass Noise als Stilmittel nicht schon lange in zum Beispiel Pop- und Rockmusik verwendet wird. Die Mittel dafür sind dabei unbegrenzt. Viele bedienen sich elektronischer Instrumente oder Software oder verwenden einfach Gegenständen, die sie zu Lärmerzeugern erklären. Nicht nur bei Rumpeln kommt dabei auch die Stimme mit ins Spiel.
Er gehört zu denen, die elektronische Effekte und Instrumente in der Performance verwenden: Auf einem kleinen Holztisch stehen eine Menge Geräte, alle irgendwie miteinander verkabelt. Manches sieht selbstgebaut aus. Allein dieses wilde Setup schafft schon Atmosphäre. Nach einem kurzen Aufbau mit bassigen Rhythmen lässt er dann schnell die Energie fließen. Die krummen Geräusche zwischen perkussiv und tonal mischen sich. Es wird dicht auf der Bühne – oder eigentlich vor der Bühne. Das ist keine Performance fürs Podest. Rumpeln rastet aus, das lässt sich nicht anders sagen. Er schlägt um sich, bewegt sich häretisch, wie bei einem Ritual. Seine langen Haare hängen ihm ins Gesicht, das man selten sieht. Es wirkt so, als käme ihm diese rhythmische Geräuschkulisse direkt aus Mark und Bein. Und schließlich beginnt er zu schreien, zu singen, zu lärmen. Ob er Text hat, lässt sich nicht verstehen, denn seine Stimme ist prozessiert. Halleffekte, Equalizer oder Filter. Gut abgestimmt auf die Lärmkulisse und distinkt hörbar als Laute, aber unverständlich. Es beschleicht jenes ein Gefühl, das man auch hat, wenn man hermetischer Kunst begegnet, man wähnt sich ausgesperrt, wie vor einer Glasscheibe, ist aber zutiefst neugierig. Und beobachtet: Absolute Entgrenzung von Formen, die wir normalerweise als bedeutungsvoll erachten. Einmal tritt er beinahe jemanden in der ersten Reihe. Dann schmeißt er ein Mikro weg, nimmt ein anderes. Pure Energie. Und eine lautpoetische Extrem-Performance.
An diesem Abend laufe ich also nicht mit einem Gedichtband nachhause, sondern mit einer Schallplatte. Die B-Seite von »Noise Means Noise« entspricht in etwa seiner Performance, wobei er sich für dort vermutlich erheblichen Improvisationsspielraum offenlässt: kontrolliertes Chaos eben. Ich persönlich wünsche mir mehr davon in der heutigen Lyrik.
Wer sich nun also mal überlegt, die Performance von Noise-Kunst zu genießen, dem möchte ich noch ein paar Sicherheitshinweise geben, denn ja: Diese Kunst fühlt sich gefährlich an! Damit man nicht gleich überrumpelt wird, lohnt es sich, einen Gehörschutz mitzunehmen. Außerdem sollte man sich den Raum ansehen. In den Ecken sammeln sich die Frequenzen und verzerren das Klangbild. Also lieber weiter vor, als man es eigentlich wagen würde, das Wagnis lohnt sich! Rumpeln macht »extrem ernste Musik«, wie er selbst sagt. Eine Anspielung auf den hie und da noch vertretenen Widerstreit zwischen E- und U-Musik. Und wer sich die Titel seiner Smashhits »Die Gruppenaktivitäten im Klassenzimmer werden durch Gespräche und Zigarettenrauch gestört« oder »Bitte keine Sportgeräte« anschaut, der weiß auch selbst ganz sicher: Hier wird ernsthaft mit Humor gespielt.

Rumpeln
Noise Means Noise
Als Vinyl- und als Digitalalbum erhältlich
Echokammer-Records
München 2022

David Westphal, geboren 1989 in München, wo er auch lebt. Studium der Philosophie, Germanistik, Literatur- und Kulturtheorie zu Gießen und Tübingen. Gedichtveröffentlichungen in verschiedenen Anthologien.
Alle bereits erschienenen Folgen von »Neugelesen« finden Sie hier.