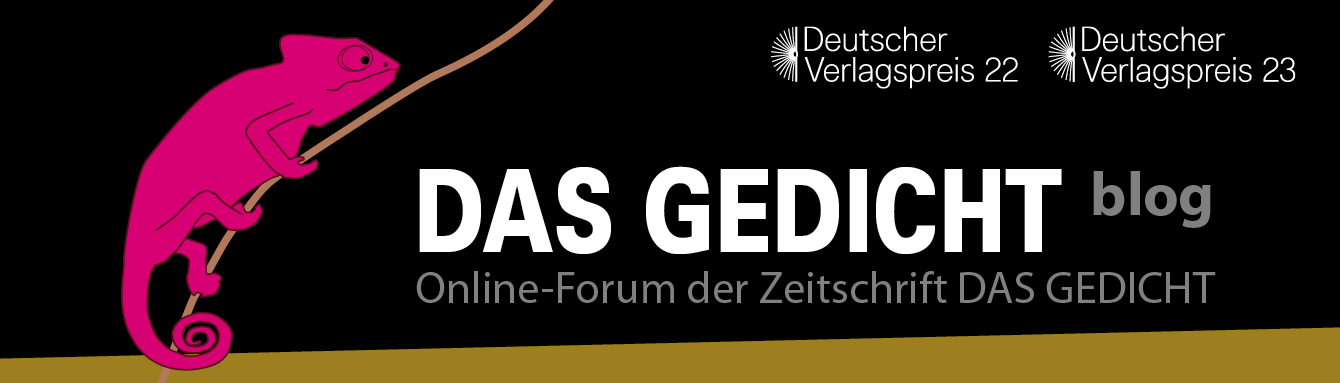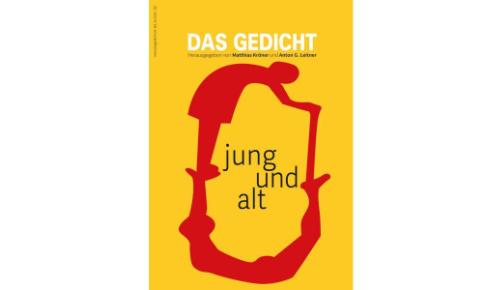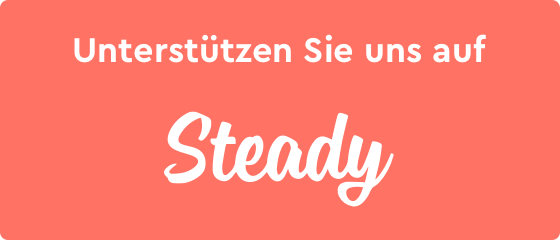Die Vorlage hier ist das Gedicht »franz hochedlinger-gasse« von Ernst Jandl (1925 – 2000). Typisch für Jandl, der gerne als wahrer Wortakrobat gerühmt wird (und dies nicht nur heuer, im Jahr seines hundertsten Geburts- und fünfundzwanzigsten Todestags), ist ja eine durchaus sehr reduzierte Sprache, kombiniert gerne auch mal mit dem bildhaften Gebrauch der Körpersäfte (wie etwa auch in seinem berühmtesten Gedicht, in »ottos mops«). Das Reduktionistische bei ihm ist dabei zuweilen als klare Regel erkennbar, die spielerisch umgesetzt wird (etwa wenn im vorgenannten Beispiel lediglich das O als Vokal eingesetzt ist), und manchmal lässt sich durchaus fragen: Meint der das ernst, oder verarscht der hier gerade einfach nur seine Leser?
Dann erreicht er eine aufgesetzte Kindlichkeit, die albern wirkt und dabei vollkommen im Banalen verbleibt. So in »franz hochedlinger-gasse«, wo er lediglich beschreibt, dass dort herumliegender Hundekot ihn vor Ekel würgen lässt. Und die in so künstlich einfachen Worten, in so bodenlos infantilen Wortspielchen, dass seine Verse weder den Ekel transportieren noch die Situation oder ihre Beschreibung irgendwie transzendieren. Karsten Paul fragt also inhaltlich durchaus nachvollziehbar, ob er von Jandl als Leser nicht einfach hopsgenommen wird. Dabei orientiert er sich in Gestalt, Sprachverwendung bzw. -umbauung und Aufbau am Original – wobei delikaterweise die fragwürdigen Jandl-Verse Position und Funktion des Hundekots im Vorbild einnehmen.
Auf eine neue Höhe hebt er die ganze Angelegenheit dabei aber schon mit dem Titel: Die real existierende Franz-Hochedlinger-Gasse des Originals ist noch wahlweise purer Zufall oder, wahrscheinlicher, nur gewählt, um eine besonders große Diskrepanz und damit humoristische Fallhöhe zu erreichen (das »Hochedle«, dem Namen nach sowie auch der Person des historischen reichen Wiener Würdenträgers, trifft auf ganz niedergegenwartsalltägliche Hundescheiße). Die Basil-Bernstein-Gasse hingegen ist eine poetische Erfindung: Sie gab und gibt es in Wien nicht. Paul führt sie ein, um auf die lyrische Vorlage hinzudeuten und dabei aber mit Basil Bernstein gleich einen großen Soziologen und Linguisten ins Spiel zu bringen. Seine Kernthese war, grob vereinfacht: Am Sprachgebrauch erkennt man den sozialen Status des Sprechers. Dass diese beiden Faktoren im Falle Jandls allgemein gerne und in seiner »franz hochedlinger-gasse« insbesondere nicht zusammenpassen, das thematisiert Paul hier in seinem Nachbild, auch und gerade in der Diskrepanz zwischen Gedichttitel und -korpus (mit welcher er selbstredend auch das Original wiederum so virtuos wie kritisch nachahmt).
Wiedergegeben findet sich das Jandl-Original »franz hochedlinger-gasse« etwa auf Planetlyrik.de: https://www.planetlyrik.de/ulf-stolterfoht-zu-ernst-jandls-gedicht-franz-hochedlinger-gasse/2023/02/
 »Gedichte mit Tradition« im Archiv
»Gedichte mit Tradition« im Archiv