Achim Raven veröffentlicht in loser Folge am 13. eines Monats Überlegungen zu Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Gedichteschreibens. Im ersten Beitrag geht es um den Vers, der weder Zeile noch Satz ist und in der Ambivalenz seiner Möglichkeiten höchsten Scharfsinn oder aber bodenlose Dumpfheit befördern kann.
Es ist kein Trost in der Welt
„Die Welt ist alles, was der Fall ist“, erklärt Ludwig Wittgenstein, also das Allgemeine schlechthin. Für solche Dimensionen aber ist der Trost viel zu klein, zu peripher und ephemer. Trost hat die Reichweite einer Armlänge und die Dauer eines Tränenflusses. Jeder Mensch kann ihn spenden und jeder kann ihn empfangen, nur eben nicht immer und überall jeder an jeden und von jedem. Trost ist nicht verallgemeinerbar, er ist intim, ein spontanes körperliches Vertrauen. Trost, wenn er gelingt, lindert den Schmerz über ein zerbrochenes Spielzeug ebenso wie über das Sterben, aber er bringt nichts zurück. Er vermittelt eine grundlose (d.h. ebenso unbegründete wie absolute) Hoffnung gegen das stumpfe Weitermachen des Faktischen. Trost schafft keine Abhilfe, aber hilft auch nicht nicht. Sonst wären Freude und Vergnügen längst vergessen, und es herrschte immer, überall und ausnahmslos die Trostlosigkeit.
Der Fall hingegen ist die unerbittliche Kausalität in der Natur, da gibt es weder Gut und Böse noch Richtig und Falsch, da herrscht unendliche Gleichgültigkeit. Die Menschen haben sich der Natur gegenüber Freiheiten ertrotzt, indem sie Richtig und Falsch unterscheiden lernten und damit Gut und Böse erfinden konnten. Auch das ist der Fall. In der Genesis wird dieser Fall Sündenfall genannt – ein allzu durchsichtiges Manöver, um einen Weltenrichter zu installieren, der unangefochten über Gut und Böse, Richtig und Falsch befindet. Dieser Weltenrichter soll auch die Befreiten vor sich selbst schützen, denn die individuelle Gewissheit über Gut und Böse erlaubt die monströsesten Machtspiele. In jedem Baumarkt sind Hämmer und Teppichmesser erhältlich, um im Namen des Guten und Richtigen Schädel zu zerschmettern und Genitalien zu verstümmeln. Leider ist der Schutz durch den Weltenrichter schwach, denn er ist selbst ein Machtspiel. Wer „Deus lo vult“ sagt, erklärt sich zum gehorsamen Knecht bzw. zur unangreifbaren Vollstreckerin des Weltenrichters und darf die Hämmer und Teppichmesser segnen. Gerechtigkeit ist ein Postulat, Selbstgerechtigkeit ein mächtiges Tool.
Natürlich darf man das alles nicht so einseitig sehen, es gibt ja auch viel Schönes, das das Leben lebenswert macht, sodass selbst Machtspiele allseitiges Vergnügen bereiten können. Z.B. Sport.
Überhaupt produziert, was der Fall ist, endlose Ambivalenzen: Da spaziert ein über beide Ohren verliebtes Nazipärchen kichernd durchs Phantasialand, da krakeelen im Stadtpark fröhlich die Halsbandsittiche, während die Spatzen langsam verschwinden, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang bestünde, da fordern Pazifist*innen unter dem Zwang ursächlicher Zusammenhänge den Einsatz schwerer Waffen gegen Einwegsoldaten. Die Welt ist alles, was der Fall ist, vor allem aber nicht bei Trost.
„Ja, aber die Kunst!“, wird an diesem Punkt gern eingewendet. Umso prächtiger gedeiht sie, je weniger die Welt bei Trost ist. Spätestens seit dem Dreißigjährigen Krieg ist dies offensichtlich. Und genau deswegen hat das Oberkommando der Wehrmacht ab 1941 die fronttauglichen „Münchner Lesebogen“ als leichte Lesekost für Soldaten und Rüstungsarbeiter*innen herausgegeben. Denn offenbar verabreicht das Dichterwort Tröstungen in trostloser Zeit.

Doch die Trostlosigkeit ist ein weites Feld und beginnt manchmal schon da, wo eine Tafel Schokolade oder das Dichterwort als Tröstung verabreicht werden. Solche Maßnahmen erweisen sich dann als das Gegenteil von Trost, sie sollen ablenken, hinwegtäuschen über das, was der Fall ist. Sie ersetzen die körperliche Intimität des Trostes durch deren Illusion. Die Betroffenen fühlen sich in den Arm genommen, sind aber bloß auf den Arm genommen: Die Intimität des Trostes macht das, was der Fall ist, für einen flüchtigen Augenblick nichtig. Die Tröstungsverabreichungen sind ein Spektakel, das für klagloses Funktionieren sorgen soll, indem die Betroffenen sich unmittelbar angesprochen fühlen ohne es zu sein.
Für die Soldaten und Rüstungsarbeiter*innen sind die Dichterworte der Münchner Lesebogen das uneingelöste Versprechen einer unmittelbaren Ansprache. Solche Präsentation von Dichterworten unterscheidet sich nicht von den Versprechen heutiger Boulevardmedien und überhaupt dem, was Georg Seeßlen und Markus Metz als „Blödmaschinen“ bezeichnen.
Was in den Büchern der Dichter*innen steht, ist also nicht zum Trost geeignet. Denn dessen Unmittelbarkeit und Einmaligkeit, die ja auch ohne elaborierte Sprache auskommt, ist nicht verallgemeinerbar. Die Künste, speziell aber die Lyrik, um die es hier ja geht, sind elaboriert und damit verallgemeinerbar. Lyrik ist Teil dessen, was der Fall ist, indem sie die Welt zur Sprache bringt, die wiederum in ihrer Elaboriertheit zur Sache kommt. Dieser Prozess ist zwar radikal subjektiv, er nährt sich aus Freude, Trauer, Liebe, Wut, aber gerade in seiner Subjektivität ist er Teil der öffentlichen Auseinandersetzungen, genau deshalb ist er erst vollständig, wenn er veröffentlicht ist. Die Subjektivität der Lyrik schafft keine Intimität, sondern offenbart die Lücken des begrifflichen und strategischen Denkens. Als Komplement ist sie Teil dessen, was der Fall ist. Aber nicht, indem sie meinungsstark mitpalavert (Lyrik wird weder bei Anne Will noch bei Markus Lanz verlesen), sondern indem sie ausgehend von der Wirklichkeit Möglichkeiten auslotet und Potenziale erprobt. Das Ausgangsmaterial der Lyrik sind Erfahrungen und das Zeichensystem der Sprache, mit denen buchstäblich alles Mögliche gemacht werden kann, deren Grenzen sogar überschritten werden müssen. Eine derart exzentrische Veranstaltung in den Nischen dessen, was der Fall ist, kann nicht bei Trost sein.
Als Beispiel dafür ein Gedicht (auch um urheberrechtliche Umständlichkeiten zu vermeiden) aus eigener Produktion. Der unmittelbare Wirklichkeitsbezug ist denkbar schlicht: Ich war vor ein paar Jahren einmal in Bad Kissingen und habe dort ein vorzügliches Zitroneneis gegessen, und als Kind musste ich, ob ich wollte oder nicht, Pudelmützen tragen. Hinzu kommen noch ein paar kulturelle Schnippel: Komödien von Blake Edwards, das Liedgut der Arbeiterbewegung, die kirchliche Liturgie, Klopstocks Frühlingsfeier, Kim Basinger und Klaus Maria Brandauer in „Sag niemals nie“.
Zum guten Schluss
Fröhlicher Tumult und Jubelschreie
Bei den Sonnenliegen sind sie alle
Total aus dem Häuschen
Rosarote Panzer brechen durch
Den Maschendraht ins Freibad
Prustend und quietschend belegt die pinke Division
Das Schwimmer mit Arschbombenteppichen
Bloß keine letzten Gefechte jetze
Würden die letzten die ersten doch sein
Und Sonn ohn Unterlass mal gar nicht
Verwaiste Sonnenliegen
Versteppung Verwüstung
Am Ende käm bloß Asche zu sich selbst
Und Staub erst recht
Besser durchströmen Gewitterwinde
Mit lauter Woge den Wald
Und es rauscht es rauscht
Himmel und Erde vom Regen
Bis über stillem Säuseln
Der Bogen des Friedens sich neigt
Die meisten Namen
Bleiben bei ihren Dingen
Der Drehmomentschlüssel
Die Plümmelmütze
Das Freundschaftsspiel
Schluss aber mit den schlechten Küssen
Nie mehr zähe Spuckefäden
Bad Kissingen can possibly be renamed
Und dann Zitroneneis für alle
Dafür braucht‘s gar keine pinke Division
© Achim Raven

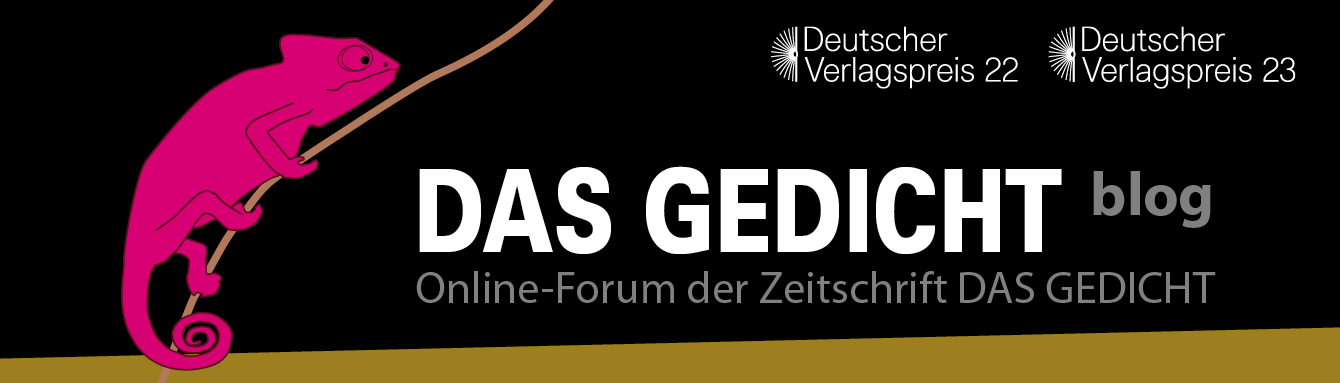

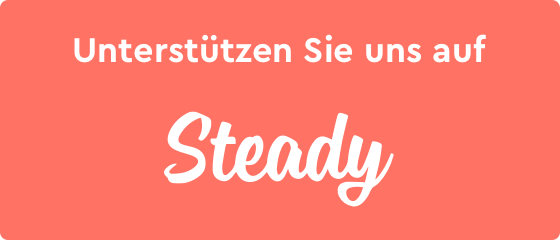

Ja, es ist “kein Trost in der Welt”, aber die Weltbewohner*innen gieren danach (berechtigt) und er muss entgegen A. Ravens Ansicht auch nicht immer nur flüchtig sein und kann auch anders als durch körperlichen Trost erzeugt werden.
“Bei den Sonnenliegen sind sie [zwar] alle total aus dem Häuschen”, weil die Sonne Trost spendet und die Lebensgeister weckt, besonders aber wenn die “rosaroten Panzer”, kurz die “pinke Division” mit ihren “Arschbombenteppichen” im “Schwimmer” ein Spektakel inszenieren, das den Ausbruch aus der Trostlosigkeit real erscheinen lässt.
Der rosarote Panther, https://de.wikipedia.org/wiki/Der_rosarote_Panther_(1963), den Raven in seinem Gedicht zum Panzer mutieren lässt, der exakt das Gegenteil von Trost bringe, nämlich “Versteppung” und “Verwüstung”, wird von Raven mit “Gewitterwinde[n]” und “Regen” konfrontiert, die, so seine Hoffnung, gegen die “Verwüstung” den “Bogen des Friedens” über das wieder fruchtbare Land spannen können. “Zitroneneis für alle” ist dann in der letzten Strophe der verzweifelt-hoffnungsvolle Kontrapunkt, den Raven gegen die strukturell bedingte Menschenfeindlichkeit setzt und der angeblich jede “pinke Division” überflüssig mache.
“Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch” (Adorno) möchte ich A. Raven nicht als Argument entgegenhalten (zumal sein Gedicht wahrscheinlich vor Beginn des Russland-Ukraine-Krieges geschrieben wurde), weil das, was zur Zeit im Krieg in der Ukraine oder z.B. im Jemen stattfindet, die Dimensionen des Nazi-Vernichtungskrieges einschließlich der systematischen Vernichtung von Juden, Kommunisten, Sozialdemokraten, Sinti und Roma, Homosexuellen und Behinderten auch nicht annähernd erreicht. Dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass unter obwaltenden Weltbedingungen die Zeit für Lyrik nicht ganz, aber doch tendenziell stillgelegt sein könnte. Wie fragil aber auch solche Argumentation ist verrät bereits an dieser Stelle meine Wortwahl, denn eine Stilllegung kann logisch nicht tendenziell sein, sondern nur absolut, sonst ist es nicht still.
Wende ich mich den vor dem Gedicht erläuternden Darlegungen von A. Raven zu, bleibt meine Perspektive selbstverständlich kritisch, findet aber kaum so scharfe Kritikpunkte wie die am Gedicht. Kernaussage in den einleitenden Bemerkungen ist meiner Auffassung nach folgende:
“Doch die Trostlosigkeit ist ein weites Feld und beginnt manchmal schon da, wo eine Tafel Schokolade oder das Dichterwort als Tröstung verabreicht werden. Solche Maßnahmen erweisen sich dann als das Gegenteil von Trost, sie sollen ablenken, hinwegtäuschen über das, was der Fall ist. Sie ersetzen die körperliche Intimität des Trostes durch deren Illusion. Die Betroffenen fühlen sich in den Arm genommen, sind aber bloß auf den Arm genommen: Die Intimität des Trostes macht das, was der Fall ist, für einen flüchtigen Augenblick nichtig. Die Tröstungsverabreichungen sind ein Spektakel, das für klagloses Funktionieren sorgen soll, indem die Betroffenen sich unmittelbar angesprochen fühlen ohne es zu sein.”
Richtig ist daran erst einmal, dass “Tröstung” nicht selten exakt das Gegenteil von realem Trost ist, weil “Tröstung” bereits die Interessen der Tröstenden enthält, die gänzlich andere Interessen verfolgen können oder müssen als diejenigen, die des Trostes bedürfen. Richtig ist auch die sprachlich wie inhaltlich treffende Sequenz, in der “in den Arm genommen” kritisch-satirisch als “auf den Arm genommen” gewendet wird, allerdings mit der oben beschriebenen Verkürzung auf “körperliche Intimität”, die A. Raven als die fälschlicherweise einzige Möglichkeit von Trost erscheint. Richtig ist aber auch wieder die Konklusion seiner Argumentation, dass nämlich die “Tröstungsverabreichungen” für “klagloses Funktionieren” der angeblich Getrösteten sorgen soll.
Bezieht man die Diagnose von A. Raven, es gebe keinen Trost in dieser Welt, die mMn im Kern richtig ist (auch wenn nicht auf “körperliche Intimität” reduziert), speziell auf die aktuelle Lage, v.a. Dingen auf den Russland-Ukraine-Krieg, dann ist diese Aussage vorläufig in besonderer Weise richtig (man könnte auch sagen, sie ist wahr, aber das traut sich kaum noch einer zu sagen). Nur, leider bietet A. Raven bis auf seine Naturmetaphorik, Gewitter und Regen, bei der ich mich frage, von wem oder wodurch A. Raven Gewitter und Regen erwartet/erhofft, keinerlei Perspektive. Nun könnte es aber auch so sein, dass es keine Perspektive mehr gibt außer einer zufälligen oder durch materielle und ideelle Erschöpfung hervorgerufenen auf der Basis des irrationalen Selbstzwecks des Kapitals und der diesen Selbstzweck ebenso irrational exekutierenden Staaten. Das aber will A. Raven nicht akzeptieren, sonst hätte er nicht als heimtückischer Dialektiker, der er ist, “Zitroneneis für alle” gegen die “pinke Division” gefordert. Und da bin ich, trotz oder wegen (?) meiner Kritik wieder bei ihm.
Zusatzbemerkung 1: Meine vorgetragene Kritik ist in dieser Form und diesem Inhalt nur möglich, weil ich von der Kritikwürdigkeit A. Ravens weiß. Diese Bemerkung ist fundamental wichtig, weil dies in der gegenwärtigen Ödnis journalistischer und politischer Debatte*, sofern man es überhaupt noch Debatte nennen kann, bemerkenswert ist.
Zusatzbemerkung 2: Falls ich das Gedicht wieder auf falscher Ebene kritisiert haben sollte, nämlich auf inhaltlicher, oder gar erneut, wie schon einmal hier, kriminalistisch vorgegangen sein sollte, bitte ich, mich darauf hinzuweisen.
*Abschlussfrage: Gibt es eine literarische oder allgemein kulturelle Debatte, die nicht an “Versteppung” und “Verwüstung” leidet? Mir fehlt da der Überblick.
Nachdem die Debatte nun eröffnet ist:
Ein Unterschied zwischen dem Gedichteschreiben und dem Argumentieren besteht darin, dass man sich beim Argumentieren immer fragen muss „Wie anfangen?“, dass einem beim Gedichteschreiben dagegen die Anfänge zufliegen und die entscheidende Frage lautet „Wie und wann aufhören?“
Wie und wo fange ich jetzt also an? Am besten bei der Zusatzbemerkung 2, weil die ein bisschen rätselhaft ist. Sie bezieht sich auf Folge 13 des kniffligen Poesiepuzzles https://dasgedichtblog.de/das-knifflige-poesiepuzzle-folge-13-ermittlungen-im-gedicht/2022/03/13/, in der es u.a. darum geht, dass man Gedichten auf kriminalistische Weise nur bedingt beikommt. Gemeint ist damit ein wissenschaftsaffines Verfahren, das am Ende nichts ungeklärt lässt. Ein wildes Geschehen wird in eine rationale Erzählung mit Anfang, Mitte und Schluss verwandelt, die Wildheit in kausale Verschränkungen überführt. Mit diesem Verfahren wird das Besondere im Allgemeinen aufgehoben. Bei einem Mord hat das eine kathartische Wirkung, bei einem Gedicht eine destruktive.
Georg Noé überführt das Gedicht, dessen Titel „Zum guten Schluss“ ja schon nicht ohne Ambivalenz ist, in ein Szenario, das angesichts der gegenwärtigen Zustände naheliegt: Der Panzer bringt Versteppung und Verwüstung, das Spektakel im Schwimmbad ist Propaganda. Diese Vorstellungen sind dicht an der Wirklichkeit, wenn man an Putins denkwürdigen Auftritt kürzlich in Mariupol denkt.
Im Gedicht ist die Szenerie allerdings weniger gespenstisch als karnevalesk, die pinke Division hat soviel Militärisches wie die Rosa Funken https://de.wikipedia.org/wiki/Rosa_Funken in Köln, und der augenfällige Hinweis auf Blake Edwards Filme enthält noch einen zweiten, nicht ganz so augenfälligen: In seiner Komödie „Unternehmen Petticoat“ https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen_Petticoat gibt es ein rosa angestrichenes schweres Kriegsgerät (kein Panzer zwar, dafür ein U-Boot), um das sich vor dem Hintergrund des Krieges im Pazifik 1941/42 eine Fülle unmilitärischer Episoden rankt. Dass dieser subversive Spaß hollywoodtauglich und mainstreamkompatibel glattgebügelt ist – Cary Grant, Tony Curtis! –, macht ihn noch nicht zur Kriegspropaganda, dazu feiert er allzu sehr die Disziplinlosigkeit, selbst wenn diese auch als Gegenbild zur grotesken Massendisziplin der Achsenmächte gelten kann.
Neben dem „rosaroten Panzer“ sind die Bildbereiche „Versteppung” und „Verwüstung” sowie die „Gewitterwinde Mit lauter Woge“ von Belang. Deren Verknüpfung mit der „pinken Division“ ergibt nur Sinn, wenn die „Arschbombenteppiche“ die Artilleriemunition endgültig ersetzen. Wenn Militäraktionen nur noch disziplinlose Schwimmbadvergnügungen sind, ist das vielleicht auch erreicht, was das „Stille Nacht, heilige Nacht“ des Marxismus-Leninismus mit der flauen Metapher „scheint die Sonn ohn’ Unterlass“ ausmalt. Schon 1974 hat https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Seyfried spöttisch darauf hingewiesen, dass diese Metapher eigentlich eine Klimakatastrophe markiert. Das Gegenbild habe ich deswegen mit dem gebührenden Unernst (und nicht aus dem ranzigen Entzücken an Naturmetaphern) aus der „Frühlingsfeier“ von Klopstock https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Gottlieb_Klopstock genommen, in dem immerhin der Regenbogen als „Bogen des Friedens“ erstrahlt, unter dem das rosarot Militärische am Ende nicht einmal mehr zur Parodie taugt und das Zitroneneis die Wertschätzung erhält, die ihm zusteht. Bei Heine waren es Zuckererbsen.
Mit diesem Material hätte ich auch ein Feuilleton oder eine Abhandlung schreiben können, in der es u.a. um den absurden Geschichtsdeterminismus des Marxismus-Leninismus https://de.wikipedia.org/wiki/Marxismus-Leninismus, die deutsche Empfindsamkeit https://de.wikipedia.org/wiki/Empfindsamkeit und die Aktivitäten der Situationistischen Internationale https://de.wikipedia.org/wiki/Situationistische_Internationale ginge. Das wäre aber ein völlig anderer Text mit völlig anderen Maßgaben. Da müssten um des Themas willen Sachen zur Sprache gebracht werden. In einem Gedicht aber muss die Sprache zur Sache kommen, indem Sachthemen wie musikalische Themen behandelt werden, „[…] man muss diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt!“ – seltsam, wie sehr hier das Marx-Zitat passt, obwohl es etwas ganz anderes intendiert.
Bei solchen Überlegungen geht es wohlgemerkt nicht um Eigeninterpretation, sondern um das im Gedicht verwendete Material und die Möglichkeiten seiner sprachlichen Realisierung. (vgl. auch Das knifflige Poesiepuzzle, Folge 17: Empfindsamkeit, Material und Arbeit https://dasgedichtblog.de/das-knifflige-poesiepuzzle-folge-17-empfindsamkeit-material-und-arbeit/2022/11/22/).
Dieses Material und die Möglichkeiten seiner sprachlichen Umsetzung sind immer auch Teil dessen, was der Fall ist. Bis zum Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus konnte die Kunst sich in der Antithetik von Kunst und Leben einrichten. „Was unsterblich im Gesang soll leben, Muss im Leben untergehn“, heißt es bei Schiller, später durfte Lyrik den antibürgerlichen Gestus pflegen, sich politisch radikalisieren und als moralische Instanz auftreten. Diese Illusionen hat der Zivilisationsbruch zerstört. „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch” heißt: Gedichte haben sich als Teil der Barbarei erwiesen. Adorno hat ja nicht gesagt (wie gern unterstellt wird): „Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist geschmacklos.” Wer so argumentiert, hält Barbarei für eine Geschmacksfrage. Barbarei ist eine Praxis, in der Leben nur so lange Wert hat, bis seine Auslöschung als vorteilhaftere Option erscheint. Gedichte, egal, ob sie harmlos und friedfertig daherkommen, versiert und kunstfertig oder laut und kämpferisch – Gedichte sind Teil dieser Praxis und können dem nicht entkommen. Die alte Antithese ist zu Asche zerfallen. Die Stilllegung der Lyrik wäre deshalb bloß fade Symbolpolitik, die nur denen etwas bringt, die das Setzen von Zeichen mit aktiver Politik verwechseln. Ihren Sinn hat Lyrik nur darin, dass die Barbarei untilgbar in sie eingeschrieben ist und sich nicht ideologisch schönreden lässt. Lyrik – Kunst überhaupt – ist kein stylishes Ambiente (vulgo: keine Blümchentapete) für Befindlichkeiten, sondern ein schwärendes Ekzem an der Oberfläche dessen, was der Fall ist. Ihre Bedeutung liegt in ihrer Trostlosigkeit, die sich gern mit dem schönen Schein tarnt.
Und dann bleibt da noch die Sache mit dem Trost und den Tröstungen.
Trost ist keine Aufmunterung angesichts misslicher Zustände. Bei sowas können schönes Wetter, Ausgehen mit Freund*innen, kluge Bücher tatsächlich helfen. Zum Glück. Noch besser hilft praktische Solidarität und alles, was Probleme löst. Beim Trost aber geht es ums Ganze, nicht nur um Misslichkeiten. Trost braucht, wer buchstäblich fertig ist mit der Welt, wer kein Land mehr sieht, wer verloren zu gehen droht. Diese Verlorenheit ist in jedem Augenblick und bei jeder Person eine andere, sie ist nicht abstrahierbar, sie ist primär körperlich, erst sekundär psychisch.Wie Hunger, aber der lässt sich immerhin zivilisieren. Trost ist die spontane körperliche Reaktion auf einen unzivilisierbaren Zustand.
Die so genannte Trauerkultur hilft da gar nichts, sie schafft Surrogate, die bestenfalls ablenken können, Weisheiten, stimmungsvolle Inszenierungen, chemische Hilfsmittel, Vertröstungen eben. All dies hat durchaus Wirkungen, macht aber aus dem Trauernden ein Exemplar, das (irgend)ein personalisiertes Trauererlebnis verabreicht kriegt.
Etwas ganz Spezielles dabei sind die Tröstungen. Mit denen wird man versehen. Dazu findet die Suchmaschine an erster Stelle:
„Anzeige https://www.amazon.de/buecher/bestseller Christliche trostworte kaufen – Amazon.de®:offizielle Website Entdecken Sie Tausende Produkte. Lesen Sie Kundenbewertungen und finden Sie Bestseller. Erhalten Sie auf Amazon Angebote für christliche trostworte im Bereich Bücher.“
Es ist vertrackt, sehr sogar. Deshalb hilft hier nur ungeschütztes Argumentieren, das man gemeinhin in social media tunlichst bleiben lassen sollte, weil solches dort nahezu ausschließlich Vernichtungsgeschrei gegen den ungeschützt Argumentierenden hervorruft. Hier im “Das Gedicht blog” scheint mir eine kleine Schneise geschlagen zu sein, in der das nicht geschehen muss. Deshalb also ungeschützt und sicherlich auch (partiell oder ganz?) ins Unreine gedacht, zumal reines Denken als nach außen abgeschlossene Handlung ohnehin eine Schimäre ist, weil eben auch das Denken dem barbarischen Zusammenhang nicht ganz entkommt.
“Die alte Antithese ist zu Asche zerfallen” (A. Raven) lässt sich mindestens auf dreierlei Weise lesen. Asche ist im Vergleich zum Verbrannten der sichtbare materielle Rest und nutzlos. In andere Verwendung überführt lässt sich damit aber sowohl Glatteis bestreuen, um sicheren Tritt zu gewährleisten, Ungeziefer abschrecken, mancherlei reinigen usw. als auch als Bestandteil von Schießpulver Lebensgefährliches produzieren. Nichts vergeht, alles wird aufgehoben und verwendet – gezielt und planvoll von Menschen und in anderen, nicht gesellschaftlich vermittelten natürlichen Prozessen.
Die Antithese ist Teil des Ganzen, was der Fall ist. Sie ist durch den Zivilisationsbruch (NS) nicht in dem Sinne zerstört, dass sie gar keine Funktion mehr hat oder gar verschwunden ist. Die Antithese existiert geschwächt weiter, gleichsam in den Ritzen, Unebenheiten und Unvollkommenheiten der Barbarei, möglicherweise auch als Gedicht, wenn es denn ein “schwärendes Ekzem” ist, also immerhin ein Symptom, das die Barbarei verdeutlichen kann. Ist aber ein Gedicht nur “schöner Schein”, kommt nicht die “Sprache zur Sache”, da mag es noch so musikalisch daherkommen, es ist nur Sprache ohne Sache. Selbstredend kommen “schwärendes Ekzem” und “schöner Schein” nicht in reiner Form vor. Zuckersüße Lyrik kann möglicherweise sogar ein “schwärendes Ekzem” sein, dass bereits nach innen geschlagen ist, also subkutan oder gar subversiv wirkt. Erwähnenswert scheinen mir in diesem Zusammenhang auch Kunstmischungen, etwa Musik und Lyrik, wie z.B. im Werk von Randy Newman, der mit zuckersüßen Melodien bitterböse Lyrik präsentiert. Dazu kommen Produktions- und Rezeptionskontexte – aber lassen wir das.
Die dritte Lesart bzgl. der zu Asche zerfallenen alten Antithese kommt ohne Fragen zur Sache, was nämlich überhaupt diese Antithese war, was daran alt gewesen ist und warum sie überhaupt verbrannt werden konnte, nicht aus. A. Raven streift in seiner Replik auf meinen Diskussionsbeitrag zweimal diese Antithese, indem er die “flaue Metapher” aus “Die Internationale” zitiert (“scheint die Sonn’ ohne’ Unterlass”) und den “absurden Geschichtsdeterminismus des Marxismus-Leninismus” erwähnt. Damit wird angedeutet, woran die Antithese u.a. “krankte” und der These gleichsam anbot, sie durch gezielten Beschuss zu Asche zerfallen zu lassen – an Lyrikinsuffizienz und an mechanistisch-deterministischer Entwicklungsvorstellung, kurz (und erweitert) am Arbeitermarxismus, in dem das Proletariat revolutionäre Klasse ist (!) und quasi zwangsläufig die Verhältnisse umstürzen wird. Nichts dergleichen ist richtig (und deshalb auch nicht eingetroffen), aber das damit benannte Alte und “Kranke” der Antithese, später lyrisch gewürzt durch Aufschwingen zur moralischen Instanz, eine weitere Verfehlung, hat den Kern der Antithese, den man in der Asche mit beharrlicher Suche in kleinen Partikeln finden kann, nicht zerstört und nicht widerlegt. Die Antithese geht ums Ganze, um die Umwälzung der herrschenden Verhältnisse, gegen G-W-G’, gegen den irrationalen Selbstzweck das Kapitals, also gegen den Waren-, Kapital-, Geld- und Lohnarbeitsfetisch, was zur Zeit an den Hegemonialkonflikten (Wirtschaftskrieg und Schießkriege), am Klimawandel, an global wachsender sozialer Ungleichheit der Lebenschancen usw. studiert werden kann.
“Militäraktionen” sind eben noch nicht nur “disziplinlose Schwimmbadvergnügungen”, die “Arschbombenteppiche” können bis jetzt eben nur “karnevalesk” die “Artilleriemunition endgültig ersetzen”. Was der Fall ist, was Sache ist, kann als vorläufiger Sieg der These, also der herrschenden Verhältnisse begriffen werden. Was die Antithese aber wie “Phönix aus der Asche” wiedererstarkt beleben kann, sind die schweren Krankheiten der alten These, also der herrschenden Verhältnisse (zugespitzte Widersprüche).
Zum guten Schluss:
– Ob ich die selbst auferlegte Scheu, ja fast das selbst gewählte Handlungsverbot von Künstler*innen, über ihre Kunst zu sprechen und diese zu erläutern, je verstehen werde, ist unwahrscheinlich. A. Raven schreibt: “Bei solchen Überlegungen [gemeint sind seine Überlegungen] geht es wohlgemerkt nicht um Eigeninterpretation, sondern um das im Gedicht verwendete Material und die Möglichkeiten seiner sprachlichen Realisierung.” Es klingt wie eine Entschuldigung für seine Antwort auf meinen Kommentar, nur dass er sich nicht bei mir entschuldigt, sondern bei irgendwelchen anderen Rezipienten, die seine Überlegungen als “Eigeninterpretation” auslegen könnten, was er offenbar vermeiden will. Ich freue mich im Gegensatz dazu über seine Antwort. Geht es darum, dass Kunst (hier ein Gedicht) rätselhaft bleiben muss/soll und Erläuterungen des Künstlers diesen besonderen Schatz der Kunst zerstören könnten? Außerdem, sind “Überlegungen” zum “verwendete[n] Material” und zu den “Möglichkeiten seiner sprachlichen Realisierung” nicht genau auch “Eigeninterpretation”?
– Nun gut, auch ich habe getrickst. Erstens habe ich mich zu Beginn meiner Replik als ungeschützt ausgegeben, was nur zum Teil stimmt. Zweitens habe ich mich in der “Anschleimphase”, wie Harry Rowohlt gesagt hätte, demütig dargestellt, indem ich auf mein “Denken ins Unreine” hingewiesen habe (captatio benevolantiae), obwohl ich längst nicht alle meiner Überlegungen für sonderlich “unrein” halte, also gar nicht so demütig bin. Drittens habe ich erneut A. Ravens Kommentar hemmungslos als Steinbruch für das benutzt, was ich in meiner Replik unterbringen wollte. Dabei sind wahrscheinlich Steine unbeachtet geblieben, die Beachtung verdient gehabt hätten, und Steine gedreht und gewendet worden, die für A. Raven nicht so bedeutsam sind, wie sie es für mich sind.
Das volle Ausmaß der Vertracktheit wird allmählich sichtbar, und in den Steinbrüchen bleiben die Steine liegen. Ein paar immerhin werden zu Argumenten verbaut. Im Kern geht es ja weiterhin um die Frage, wie die Sprache sich zu dem verhält, was der Fall ist, dessen Bestandteil sie zugleich ist. Ihr Status ist der einer relativen Autonomie. Autonom, weil die Regeln der Semantik und der Syntax mehr ermöglichen als die Schulweisheit sich träumen lässt. Relativ, weil sie Ausdruck sozialer Beziehungen ist. Ohne dieses Bezugssystem wäre sie eine konfuse Ansammlung von Körpergeräuschen bzw. Krakeln.
In ihrer relativen Autonomie hat sie zwei Tendenzen:
Einmal ermöglicht sie die Dialektik der Abbildung und der Konstitution von Wirklichkeit. Damit funktioniert sie als alltagstaugliche Regelungsinstanz, sowie als Medium der Widerspiegelung und Bedingung der Möglichkeit von Analyse, Verstehen, Erklären, also Rationalität.
Gegenläufig dazu verhält sich ihre andere Tendenz: Diese ermöglicht das Spannungsfeld von überschießendem Vorstellungsvermögen und Halluzination. Damit ist sie alltagsuntauglich, kann dafür aber rücksichtslos die Möglichkeiten von Syntax und Semantik (incl. aller Regelverstöße) nutzen, ohne aus ihren sozialen Beziehungen auszutreten. Auf diese Weise kann sie zwischen dem Gemeinten und dem Gesagten unterscheiden, wo die alltagstaugliche Sprache diesen Unterschied nicht gelten lassen darf. Sie macht z.B sichtbar, dass es etwas unfreiwillig Komisches hat, die sozialistische Utopie z.B. in eine Naturmetapher (unentwegter Sonnenschein) zu packen, oder aus der Perspektive eines Allwissens – weil, die Partei, die Partei, die hat ja immer recht – die Geschichte der Klassenkämpfe in ein blutiges Melodram mit Happy End umzudeuten. Darüber hinaus kann die alltagsuntaugliche Sprache der unfreiwilligen Komik die beabsichtigte des rosaroten Panzers und seiner Besatzung entgegensetzen, um das Schräge, das Unangemessene, das Kontraproduktive schiefer Naturmetaphern bzw. der schiefen Logik deterministischer Heilserwartungen hervortreten zu lassen.
Solche Sprach- und Gedankenspiele ersetzen freilich nicht die rationale Analyse, können aber in ihrem gezielten Unernst verhindern, dass die schiefen Bilder und die schiefe Logik mit ihrem feierlichen Ernst die Rationalität vergiften. So erweisen sich in der Praxis die alltagstaugliche und die alltagsuntaugliche Sprache als Vor- und Rückseite derselben Medaille, die rationale Erfassung der Wirklichkeit ist ohne überschießendes Vorstellungsvermögen nicht zu haben. Und auch umgekehrt, sonst rutscht das Vorstellungsvermögen ins Halluzinatorische.
Bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein speiste sich aus dieser Antithetik von freiem Spiel und sprachlichem Realismus der bürgerliche Glaube an den Dualismus von Kunst und Leben. Das Schöne und das Wahre (zusammen mit dem Guten) hatten ihren jeweiligen Platz wie in einer Kommode mit zwei aufgeräumten Schubladen. So ließ das bürgerliche Leben sich kommod einrichten, um die Turbulenzen der Zivilisation gelassen zu überstehen.
Mit dem Nationalsozialismus aber erwies sich, was das überhaupt für eine Medaille ist, auf der Notwendigkeit und Freiheit, Leben und Kunst, Rationalität und Phantasie, alltagstaugliche und alltagsuntaugliche Sprache als Vorder- und Rückseite prangen: Es ist die Barbarei der an sich selbst irre gewordenen Naturbeherrschung. Damit aber ist die komfortable Dualismus, die kommode Kommode verbrannt und zu Asche zerfallen.
In der Tat ist diese Asche durchaus von nachträglichem Nutzen z.B. als Dünger für die Kulturindustrie bzw. die Gesellschaft des Spektakels, zugleich kann sie, was so schön und bunt herumtrötet, grau und bitter machen, sie kann sogar – wie in Pompeji – das Vernichtete konservieren, sogar den sauberen Dualismus, für den sie als Kommode stand.
So weit, so zutreffend. Georg Noé geht jedoch einen entscheidenden Schritt weiter, indem vehement darauf hinweist, dass bei all den Möglichkeiten, die die Sprache wahrnehmen kann und soll, ihre Autonomie doch eben doch nur eine relative ist. Die beiden Seiten der Medaille sind letztlich doch nur Ausprägungen ihrer Substanz, der gesellschaftlichen Wirklichkeit in all ihrer kruden Faktizität. Mit anderen Worten: Die Sprache kann zur Sache kommen, aber nicht werden. Um Missverständnissen vorzubeugen: Sie kann sehr wohl Objekt der Betrachtung werden, aber sie kann nicht werden, was sie bezeichnet, das wäre Magie – in dieser Hinsicht ist Sprache immer Metapher. Ihr Vorteil (wenn ich „Stein“ sage, muss ich nicht fürchten, dass er mir auf die Füße fällt, kann mich aber mit ihm auseinandersetzen) ist zugleich ihre Schwäche. Ihre Aussagen haben keine Macht über das, was der Fall ist. Auch der Befund „Barbarei der an sich selbst irre gewordenen Naturbeherrschung“ ist nur eine Metapher und richtet nichts aus. Die Faktizität ist nur durch Fakten zu beeinflussen. Dabei ist jedoch entscheidend, ob diese Fakten reflexhaft blind geschaffen werden, oder ob sie in Einklang stehen mit der rationalen Erfassung der Wirklichkeit und dem überschießenden Vorstellungsvermögen. Die Schwäche der Sprache ist doch weiderum auch ihre Stärke, egal ob sie nun Theorie produziert oder Kunst – dieser in der Tat beträchtliche Unterschied ist keine Differenz ums Ganze, denn beide stellen das infrage, was der Fall ist, die Faktizität.
Noch eine kurze Anmerkung zur „Eigeninterpretation“:
Das hat nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun, sondern damit, dass das Gesagte immer einen Sinnüberschuss gegenüber dem Gemeinten hat. Die alltagstaugliche Sprache kann diese Differenz vernachlässigen oder diskursiv bereinigen. Das ist in der alltagsuntauglichen Sprache der poetischen Bildlichkeit nicht möglich, in ihr gelten alle Möglichkeiten, die der Text hergibt, und das ist prinzipiell mehr als einzelne Sprachanwender*innen absehen können. Eigeninterpretationen sind die noch falschere Antwort auf die ohnehin schon falsche Frage „Was will der Dichter uns damit sagen?“ (Diese Frage ist so falsch, dass es völlig wurscht ist, ob sie gegendert ist oder nicht …, die richtige Frage ist einfach: „Was gibt der Text her?“)
In diesem Sinne.