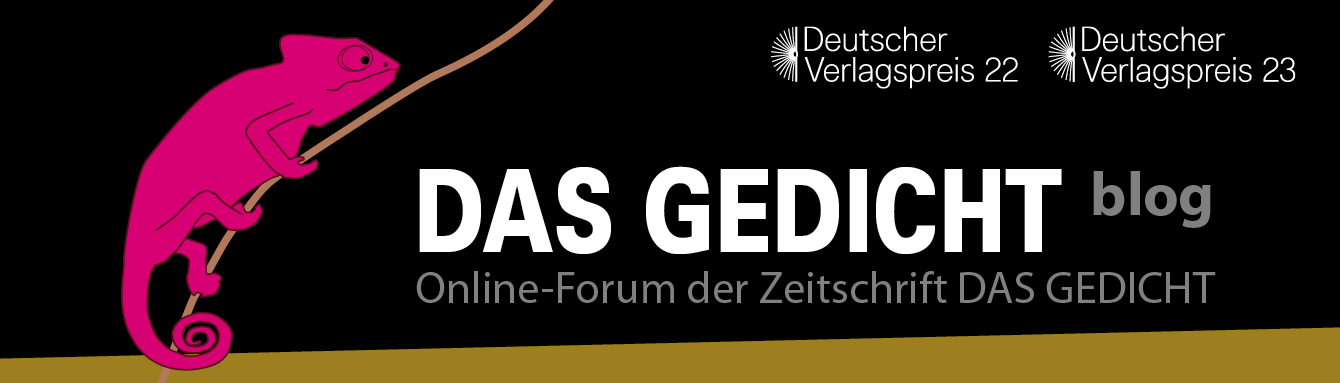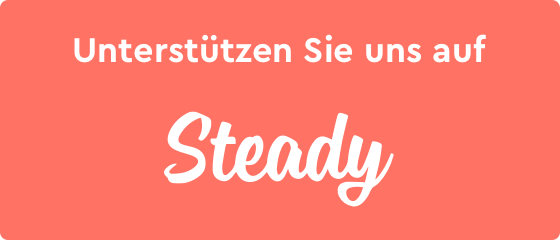»Veni, vidi, vici!« Wer kennt sie nicht, diese durchaus unbescheidenen Worte des auf Gegenwartspropaganda und Nachruhm stets bedachten Sprosses der Julier, der die Macht im alten Rom an sich riss und die erschütterte Republik zu einem Alleinherrscher-Staat umformte? Vor rund 2.000 Jahren schrieb Cäsar, Machtpolitiker, Feldherr und parteiischer Chronist, wohl quasi mit eisenbeschlagener Pfauenfederspitze nieder, dass er kam, sah und siegte – und ließ diese angeberische Aussage auch von seinen Mannen auf ein Schild übertragen, welches auf seinem Triumphzug nach der nur vierstündigen Schlacht bei Zela gegen die Truppen des Pontus mitgeführt wurde.
Vom Kriegerischen überführt nun Christian Engelken eines der berühmtesten Zitate der Weltgeschichte, das zwar kein Gedicht ist, aber von höchster sprachlicher Virtuosität, aufs Feld der Liebe – manche mögen sagen, er bleibt damit in der gleichen Region, andere mögen befinden, dass er hiermit das Feld so vollkommen und weitreichend wechselt, als ginge es von der Erde zum Mond. (Letztere seien an dieser Stelle beglückwünscht!) Auf diese Weise präsentiert er auch den starken Mann, den ewigen Polit-Star, in einer ungewohnten Rolle: Jener des schwachen Mannes, des erlegenen Liebhabers. Das irritiert – und erscheint, weiß man doch um ihn und Kleopatra, zugleich auch naheliegend.
Pointiert-pathetische Propaganda wird herrlich heitere Harmlosigkeit – und doch bleibt der lakonisch-flapsige Grundton im Grunde erhalten, und auch am Schwung und der Eingängigkeit ändert sich wenig (nur die Mittel zu Erreichung sind teilweise, der jeweiligen Zeit geschuldet, andere).
Die Original-Angeberei wird schon durch die Großschreiberei wiedergegeben – aber angegeben wird hier mit einer großspurigen Unterwerfungsrhetorik (von freilich bedeutender Ich-Bezogenheit, die wiederum ans Vorbild erinnert). Und wie das »Kommen« hier zu verstehen ist, also ob als reines Erscheinen oder aber ob der große Feldherr sich erst im Angesicht des erfolgreichen Eroberungsabschlusses zu diesem Erleichterungs- und Freudenausbruch hinreißen lässt, ist unklar.
Kurzum: Das komische Nachbild lebt von seinen Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten, davon dass es dem Original nacheifert und konträr zu ihm steht, dass es Erwartungshaltungen zugleich unterläuft und befriedigt. Und nicht zuletzt besticht es dadurch, dass es ein knapp 2.000 Jahre altes Zitat in die Gegenwart holt – dabei aber wiederum, wie eben jenes selbst, zeitlos bleibt.
 »Gedichte mit Tradition« im Archiv
»Gedichte mit Tradition« im Archiv